|
Heinz Fischer (1903–1942)
Ein jüdischer Pianist in Berlin
mit einem Nachwort von Barbara Schieb
Teil 1
von
Herbert Henck
Inhalt
Teil 1
Kapitel 1 Einleitung
Kapitel 2 Herkunft
Kapitel 3 Konzerte
Das Konzert am 15. November 1929
Anmerkungen zu Teil 1
Teil 2
Kapitel 4 Zwangsnamen, Zwangsarbeit und „Vermögenserklärungen“
Kapitel 5 Deportation und Tod
Kapitel 6 Weitere Einzelheiten
Arbeit beim Rundfunk
Die britische Freundin
Nachträge 2015 und 2016
Einleitung zu den Nachträgen
Studium und Repertoire Fischers (1921–1926)
Weitere vier Berliner Konzerte (1928–1932)
Eine Konzertbesprechung durch Fischer (1922)
Ilse Rewalds Text über Heinz Fischer (1995)
Nachwort von Barbara Schieb (GDW, Januar 2016)
Anmerkungen zu Teil 2
Chronologie Heinz Fischer
Dank
Ausführlichere Informationen über die nächste Verwandtschaft von Heinz Fischer:
Vater: Dr. med. Julius Fischer
* 20. August 1864 in Johannisburg (Ostpreußen), † 18. Juli 1927 in Berlin
(durch Selbstmord), Praktischer Arzt und Sanitätsrat
Mutter: Frida [seltener: Frieda] Fischer, geb. Fränkel
* 22. Februar 1877 in Nürnberg, † am oder kurz nach dem 4. Mai 1942
im Vernichtungslager Kulmhof, siehe auch Anm. [23] sowie [56], Abs. 2; passim
Schwester: Lotti Fischer
* 19. April 1901 in Berlin-Pankow, † am oder kurz nach dem 4. Mai 1942
im Vernichtungslager Kulmhof, siehe auch Anm. [56], Abs. 2; passim
Folgende Personen sind ferner eingehender erwähnt (alph.):
Johann Pacholeck, Taxator des Wohnungsinventars der Fischers,
siehe Anm. [51]
Alfred Sammtleben, Verwalter des Hauses nach der Deportation der Fischers,
siehe Anm. [59], Abs. 2 und 3
Walther Schliepe, Kaufmann, mit Frau und Tochter Rotraud, Mieter der Fischers
seit 1934; siehe Anm. [53]
Kapitel 1
Einleitung
Anlass nachstehender Forschungen war die Uraufführung der Sonate für Klavier Nr. 13 sowie eine Aufführung der Suite für Klavier Nr. 5 des aus Siebenbürgen stammenden Komponisten Norbert von Hannenheim (1898–1945). Beide Werke wurden von dem in Berlin-Pankow gebürtigen und dort lebenden Pianisten Heinz Fischer in einem Berliner Konzert am Freitag, dem 15. November 1929 gespielt. Da die Manuskripte der zwei nicht veröffentlichten Klavierwerke gleich den meisten anderen Kompositionen von Hannenheims bis heute verschollen sind, ging es hier vor allem darum, die erhaltenen Spuren zusammenzufassen, zu bestätigen, eventuell zu berichtigen und nach Möglichkeit zu erweitern. [1]
Dieses Bemühen mag umso verständlicher sein, als darin ein zeitliches Muster erkennbar wurde, das dem von anderen Fällen etwa glich: Die Mitteilungen über den Pianisten Heinz
Fischer versiegten plötzlich in der Musikliteratur nach 1933, und stattdessen wurde er einige Jahre später in dem von Theophil Stengel und Herbert Gerigk herausgegebenen Lexikon der Juden in der Musik verzeichnet (siehe hier). Dieses antisemitische Musiklexikon diente dazu, die Minderwertigkeit des Judentums
„wissenschaftlich“ zu belegen und die Juden in Verruf zu bringen, sie anhand ihrer Namen und Werktitel nachschlagbar zu machen, Verwechslungen vorzubeugen und solchermaßen jeden jüdischen Einfluss in der
deutschen Musik „auszumerzen“. Worüber das Lexikon schwieg – kaum aus Unkenntnis, sondern eher vorsätzlich – war der Umstand, dass zugleich für eine solche „Reinigung des
Kulturlebens“ unzählige schwerste Verbrechen von Staats wegen begangen werden konnten und dass die Juden nach ihrer vielfältigen Benachteiligung, gesetzlichen Entrechtung, berufsfremden Zwangsarbeit, dem
Einzug ihres Vermögens und der Deportation schließlich ermordet wurden. [2] In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg war Heinz Fischers Name, soweit ich es überblicken kann, für mehrere Jahrzehnte aus jeglicher Veröffentlichung verschwunden und trat erst in den Schriften über die Opfer der Shoah oder die Geschichte der Berlin-Pankower Juden allmählich wieder in Erscheinung.
Im Verlauf dieser Forschung Noten des einstigen Schönberg-Schülers Norbert von Hannenheim wiederzufinden oder ihnen selbst nur in Abschriften von fremder Hand zu begegnen, war eine sehr
vage Hoffnung, die sich trotz mancher Suche bislang auch nicht erfüllt hat. Denn es war wenig wahrscheinlich, dass der musikalische Nachlass eines deportierten und dann umgebrachten jüdischen Pianisten die
Epoche des „Dritten Reichs“ überdauert haben sollte. – Eine der wenigen Möglichkeiten, als Jude Wertgüter dem Zugriff der Nationalsozialisten zu entziehen, bestand darin,
diese Güter arischen Freunden in Verwahrung zu geben und zu hoffen, dass solche „Leihgaben“ dereinst in die Hände ihrer ursprünglichen Besitzer zurückfinden könnten. [2a] Bei Noten (Manuskripten) des Norbert von Hannenheim ist freilich nichts darüber bekannt, dass Heinz Fischer sie ähnlich einschätzte und gleichermaßen damit verfuhr, so dass Manuskripte auf
diese Weise hätten gerettet werden können. Eine Überlieferung dieser Art muss einstweilen reine Spekulation bleiben, sofern nicht sichere Quellen vorgelegt werden können.
Heinz Fischer wurde, gleich seiner Mutter Frida und seiner Schwester Lotti, von den Nationalsozialisten im Oktober 1941 in das etwa 475 km östlich von Berlin in Litzmannstadt
(Łódź) gelegene jüdische Ghetto verbracht und kam dann, ebenso wie seine beiden mit ihm gemeinsam deportierten nächsten Angehörigen, im Mai 1942 in das sogenannte Vernichtungslager von Kulmhof. [3] Fast das gesamte Eigentum des Musikers, zu dem Bücher und Noten und vielleicht auch Noten in Manuskriptform gehört hatten (siehe hier), war in Berlin verblieben und der „Gestapo“ in die Hände gefallen. Die Juden waren aus ihren anschließend versiegelten
Wohnungen abgeholt, gesammelt sowie nach Einzug ihrer „Vermögenserklärungen“ und Vornahme demütigender Leibesvisitationen mit Sonderzügen der Reichsbahn vorwiegend in die besetzten Gebiete Osteuropas
abtransportiert worden. Ihre hinterlassenen Sachwerte verkaufte oder versteigerte man, denn zu diesem Zeitpunkt glaubte kaum jemand mehr an eine Rückkehr der früheren Eigentümer. Die Erlöse vereinnahmte
die Staatskasse. Anderes kam in „Verwertungsstellen“ oder sonstige systemkonforme Einrichtungen, die auch für eine Verteilung an Parteifreunde und Gesinnungsgenossen sorgten. Einiges wurde nach Ausbruch des
Krieges verbilligt an Kriegsgeschädigte, besonders solche von Fliegerangriffen, abgegeben. Auf diese Weise gelangten viele für wenig Geld an Dinge, die sie sich unter anderen Umständen kaum hätte leisten
können. Und da aus der jüdischen Herkunft des Verkauften kein Hehl gemacht wurde und man auch offiziell verharmlosend lügend nur von einer „Evakuierung“ oder gar „Abwanderung“ [4] der Juden sprach, die nach einer Schutzmaßnahme zum Wohle der Bevölkerung, wie ein freiwilliges Verlassen der Wohnungen und beabsichtigtes
Zurücklassen von Inventar klangen, unterstützte der Verkauf von Gütern enteigneter Juden solchermaßen die rassistischen Ziele der Machthaber und ihrer Anhänger – zumindest bei den Hörigen und
Leichtgläubigen. Was mit unverkäuflichen Resten geschah, entzieht sich meiner Kenntnis. [5]
Bekannt geworden sind mir keinerlei Tonaufnahmen oder Schriftstücke von Heinz Fischer. Auch wie er aufwuchs, welche Schulen er besuchte, welche musikalische Erziehung er
erhielt, welche Stufen seine Ausbildung hatte, wer seine Lehrer waren oder welche Prüfungen er ablegte, blieb mir zunächst fast gänzlich verborgen, so dass durchaus Anlass zu weiterer Forschung bestand. [6] Über Fischers Repertoire gab es einige, vergleichsweise jedoch spärliche Zeugnisse. [7] Auf sein Klavierspiel
ging in der Nachkriegszeit meines Wissens nur eine Bemerkung von Ilse Rewald (1918–2005) ein, [8] die als überlebende Jüdin den Pianisten in ihren Erinnerungen erwähnte – am Rande zwar, doch voller Dankbarkeit. Dieser Passus Rewalds, der sich, seinem Inhalt nach zu urteilen, auf die Zeit der Juden-Diskriminierung und -Verfolgung und damit vermutlich auf die zweite Häfte der dreißiger Jahre bezieht, lautet:
„Vierhändig spielte er [Heinz Fischer] uns mit seiner Mutter Sinfonien von Beethoven vor. In dem Musikzimmer erklangen Schubert, Brahms, Mendelssohn, Grieg und Chopin. Sein Spiel
verzaubert[e] uns für Stunden in eine andere Welt. Von allen kulturellen Veranstaltungen ausgeschlossen, vergaßen wir die täglichen Schikanen und Diskriminierungen und schöpften neue Hoffnung und Kraft für
den grauen Alltag.“ [9]
Inge Lammel (1924–2015), siehe hier, die nach dem Krieg an der Berliner Humboldt-Universität Musikwissenschaft
studierte und 1975 promoviert wurde, veröffentlichte dieses Zitat auf der als Quelle benannten Webseite (die im Juni 2014 nicht mehr aufrufbar war). Darüber hinaus sind Lammel zahlreiche Veröffentlichungen in Form
von Vorträgen, Ausstellungskatalogen, Filmen und Büchern zu danken, welche das jüdische Leben in Berlin-Pankow betreffen, in diesem Zusammenhang auch die Geschichte der Familie Fischer behandeln und hierfür die
Erinnerungen der Lehrerin Sabine Rebschläger einbeziehen. Man kann vielleicht sogar sagen, dass Lammels Berichte, welche vorrangig von dem Wohnort der behandelten Personen ausgehen, einige der bislang
wichtigsten und ausführlichsten Informationen über die Juden zur Zeit des Nationalsozialismus in Pankow sind. [10]
Da Heinz Fischer gemeinsam mit seiner Mutter musizierte, ist es nicht ganz unglaubwürdig, dass seine musikalische Begabung hauptsächlich auf sie zurückging und von ihr gefördert wurde. In
ihrer „Vermögenserklärung“ führte Frida Fischer unter anderem einige musikbezogene Dinge aus ihrer Wohnung auf, so dass wohl auch sie schon eine musikalische Ausbildung oder wenigstens Klavierunterricht
erhalten hatte (siehe unten).
Zwei Fotos von Heinz Fischer sind mir bekannt geworden; sie stammen aus dem privaten Archiv von Inge Lammel. Vor abstraktem Hintergrund zeigt es den Pianisten, der in einem Sessel sitzt.
Sein Alter beträgt etwa dreißig Jahre oder etwas mehr, und das Foto könnte, sofern diese Schätzung stimmt, zu einem entsprechenden Zeitpunkt aufgenommen worden sein. Fischer trägt einen dunklen Anzug und Krawatte,
hat die Beine übereinandergeschlagen und die Ellbogen auf die gepolsterten Armlehnen des Sessels gestützt. Seine Haltung drückt eine gewisse legere Bequemlichkeit und Ungezwungenheit, zugleich jedoch
Aufmerksamkeit aus. Sein Blick ist abgewandt und wie lesend auf ein kleines Schriftstück, vielleicht einen Brief, gesenkt, das er auf dem Schoß zwischen den Händen hält. Der Ausdruck des Gesichts, das von einer
hohen, durch die Frisur betonten Stirn überwölbt ist, ist ernst, aber nicht streng oder gar unfreundlich. Der Anflug eines Lächelns scheint mir erkennbar, wobei ich jedoch den Eindruck habe, dass der Anlass dieses
Lächelns, das zugleich eine leichte Skepsis enthalten mag, eher auf den Inhalt des Schriftstücks zurückgeht, in das sich der Pianist vertieft hat, als auf eine äußere Ursache. [11]

Heinz Fischer
um 1939 photographiert. Unbekannter Photograph
Nachtrag, erhalten von Herrn Gerhard Hochhuth
aus dem „Privat-Archiv von Inge Lammel, Berlin-Pankow“
heute: GDW (Gedenkstätte Deutscher Widerstand), Nachlass Ilse Rewald, Berlin
Reproduktion mit freundlicher Genehmigung.
Weitere Informationen, die noch greifbar sind, betreffen hauptsächlich die Eltern und die Schwester des Pianisten, mehrere Konzerte, die Heinz Fischer spielte, das Pankower
Haus, in dem die Familie Fischer wohnte, Mieter der Mansarde oder verschiedene berufliche Stationen des bereits 1927 infolge Freitods verstorbenen Vaters, des
Praktischen Arztes Dr. med. Julius Fischer. Hinzu kommen aus der späteren Zeit die „Vermögenserklärungen“, die Deportation und der Tod von Frida, Lotti und Heinz
Fischer. All dieses und anderes ist, soweit es sich in Erfahrung bringen ließ, zusammengestellt. Das zweite Foto zeigt Fischer in Müncheberg in der Gruppe der „Kartoffelbuddler“ [11a], auch um 1939. Siehe Nachträge.
Kapitel 2
Herkunft
Heinz Fischer wurde am Sonntag, dem 15. Februar 1903 in Berlin-Pankow geboren. [12] Er hatte eine Schwester, Lotti mit Vornamen, die etwas weniger als zwei Jahre älter war. Sie beide waren die einzigen Kinder von Dr. med. Julius Fischer und seiner Ehefrau
Frida Fischer, geb. Fränkel.
Julius Fischer wurde am 20. August 1864 in Johannisburg in Ostpreußen geboren und
verstarb am 18. Juli 1927, aufgrund von Selbstmord, in Berlin. [13] Seit spätestens 1891
war er bis zu seinem Lebensende in Berlin-Pankow ansässig [14] und wurde seit 1902 bis zu seinem Tode im Berliner Adreßbuch dort stets als „Eigentümer“ des Hauses in
der Breiten Straße 8.9 geführt. [15] In diese Informationen fügen sich die Hinweise von
Sabine Rebschläger stimmig ein, dass Julius Fischer die Arztpraxis des 1889 mit fünfundvierzig Jahren tödlich in der Schweiz verunglückten Arztes Dr. med. Heinrich
Julius Hadlich (geb. am 31. August 1844 in Aschersleben, gest. am 6. Oktober 1889 in Clarence, Kanton Waadt, Schweiz) [16] übernahm. Diese Arztpraxis befand sich in der
Schloßstraße 9 (heute Ossietzkystraße) in Berlin-Pankow, und Dr. Fischer hatte das Grundstück Breite Straße 8/9 im letzten Jahrzehnt des neunzehnten Jahrhunderts erworben. Das großzügige mehrstöckige Haus mit einer reich gegliederten Fassade wurde danach erbaut und war ein Geschenk von Julius Fränkel, einem wohlhabenden
Nürnberger Kaufmann, an seine Tochter, welche mit Dr. Julius Fischer die Ehe einging und fortan „Frida Fischer, geborene Fränkel“ hieß. [17] Architekt des Hauses in der
Breiten Straße war der jüdische Baumeister Joseph Fränkel. [18]
Da Julius Fischer bei seinem ersten Eintrag im Berliner Adreßbuch von 1891 bereits den Doktortitel führte, [19] muss seine Promotion spätestens 1891 erfolgt sein.
Als schriftliche Arbeit ließ sich unter seinem Namen für diese Zeit wie die unmittelbar vorangehenden Jahre im Bereich der Medizin als einzige Arbeit der Titel nachweisen Zur Wirkung der Coloquinthen, [20] die als Inaugural-Dissertation am 5. November 1889 von der Medizinischen Fakultät der Universität Berlin (heute Humboldt-Universität)
angenommen wurde und in Berlin im Jahr darauf auch als Druck erschien. Hinsichtlich des Geburtsortes Johannisburg in „Ostpreussen“ erbrachte die Dissertation Klarheit, so
dass bei Dr. Julius Fischer keine Verwechslung, etwa mit „Johannesburg“ in Südafrika, vorliegen kann. [21]
Der Titel „Sanitätsrat“, der bei Fischer erstmals in dem Berliner Adreßbuch 1915 auftrat
und dann bis zu seinem Tode (1927) beibehalten wurde, war seinerzeit in Preußen gewöhnlich ein Ehrentitel, der für eine zwanzigjährige Tätigkeit an nicht beamtete Ärzte verliehen wurde. [22]
Heinz Fischers Mutter Frida [seltener: Frieda] Fischer wurde am 22. Februar 1877 als Frida Fränkel in Nürnberg geboren, [23] ihre Tochter Lotti am 19. April 1901 in Berlin-Pankow. [24] Auf das Wohnhaus in der Breiten Straße 8/9 in Pankow wurde
bereits eingegangen (siehe oben). Sabine Rebschläger schreibt über den Pavillon fernerhin: „Als Morgengabe erhielt sie [Frida Fischer] den glasverkleideten Pavillon, der
mitten im großen Garten stand.“ [25]
Kapitel 3
Konzerte
Überschaut man die Konzerte von Heinz Fischer, so wird trotz der verhältnismäßig
geringen Anzahl nachweisbarer Aufführungen deutlich, dass es sich hier nicht um vielfach besuchte gesellschaftliche Ereignisse mit Prominenz unter den Gästen gehandelt hatte.
Zwar erklangen alle Konzerte Fischers in der Reichshauptstadt Berlin, doch habe ich von einem auswärtigen Konzertieren in anderen Städten und fremden Ländern, Auftritten in
großen Sälen oder Gastspielen mit berühmten Orchestern und angesehenen Dirigenten keine Kenntnis erhalten. Eher scheinen es Konzerte in kleinem Rahmen vor einem
überwiegend traditionell orientierten oder an der Entwicklung neuer Kunst interessierten Publikum gewesen zu sein, dem es vor der „Machtergreifung“ zumeist wohl auch ziemlich
gleichgültig war, ob Juden oder nicht aufgeführt wurden oder sich unter den Spielern befanden. Anderes als die „Rasse-Reinheit“ und das „Ariertum“ der Beteiligten standen
vor 1933 im Mittelpunkt der Diskussion.
Soweit es gegenwärtig sichtbar ist, spielte Heinz Fischer auch keine Tonaufnahmen auf
Rollen oder Schallplatten ein, verfasste keine Bücher oder Aufsätze und schrieb keine Besprechungen in den Feuilletons der damals sehr zahlreichen Zeitungen, so dass er
weder ein kompetenter, „gefürchteter“ noch wenigstens häufig zitierter Kritiker wurde, auf dessen Sachkenntnis man sich beziehen konnte. Fischer studierte auch nicht bei
heute weltberühmten Lehrern an vermeintlich wichtigen Schulen und kam selbst nicht zu akademischen Ehren, so dass seine Schüler, vorausgesetzt er hatte solche, sich später
nicht auf ihren „Meister“ berufen und die Ausbreitung seiner Ideen bewirken konnten. Kompositorische Ansätze entwickelte Fischer ebenfalls nicht oder trug sie nicht in die Öffentlichkeit.
All dies sind zwar mehr oder minder Äußerlichkeiten, die aber leicht zu dem Schluss
führen könnten, dass es sich bei Heinz Fischer um keine sonderlich herausragende Begabung gehandelt habe, um einen Interpreten, dessen Tätigkeit damals wie heute nur
Wenigen bekannt ist und somit leicht zu vernachlässigen sei. Daran ändert auch die positive Wertung von Peter Gradenwitz nichts, die gewiss richtig sein mag,
zum geschichtlichen Geschehen aber nichts beitragen kann. [26] Denn wer weiß
schon etwas über die vielen verschollenen Werke des Komponisten Norbert von Hannenheim aus Hermannstadt oder die Aufführungen mit dem Cellisten Godfried Zeelander aus Amsterdam, [27] um auch hier lediglich die zwei Bekanntesten derer zu nennen, mit denen Fischer zusammenarbeitete – wenn auch nur in einem einzigen
nachweisbaren Konzert? Und wer anders könnte sich, gleich Ilse Rewald [28] oder
verschiedenen Musikkritikern, über Fischers Klavierspiel ein Urteil erlauben, ohne es jemals mit eigenen Ohren gehört zu haben?
Gleichwohl sei unmissverständlich der Umstand hervorgehoben, dass es sich bei Heinz
Fischer oder seinen Familienmitgliedern um Menschen handelte, die ihrer jüdischen Abstammung wegen ermordet wurden, und dass es völlig gleichgültig ist, ob diese gut
oder schlecht Klavier spielten. Dabei ist aber darauf hinzuweisen, wie sehr gerade jüdische Musiker nach 1933 von staatlicher Seite behindert und zurückgesetzt wurden,
so dass sie ihren Beruf nicht auf ähnliche Weise wie „Arier“ ausüben konnten und unter dem Diktat der herrschenden „reinrassigen“ Deutschen ihre musikalischen Bestrebungen
oder eingeschlagene Laufbahn oftmals besser ganz aufgeben mussten. So hatte Heinz Fischer, ungeachtet seiner Ausbildung als Konzertpianist, Zwangsarbeit als Hilfsarbeiter
in einem Berliner Malereigeschäft zu leisten oder wurde bei der Kartoffelernte eingesetzt. [29] Übrig blieben die Einstudierungen und Auftritte vor ausdrücklich jüdischem
Publikum in staatlich genehmigten Einrichtungen wie im „Jüdischen Kulturbund“, in Veranstaltungen der „Jüdischen Winterhilfe“ oder in jüdischen Hauskonzerten wie den
von Gertrud Weil veranstalteten. Als offizielle Alternative kam zunächst nur die teure, oft aber lebensrettende Auswanderung ins nichtdeutsche Ausland in Frage, wo freilich der
Krieg, die Besatzung oder der „Anschluss“ die Ausgewanderten schnell wieder einholen konnte, sofern sie sich nicht weit genug vom „Deutschen Reich“ entfernt hatten. Doch
auch diese Alternative der Auswanderung, wurde alsbald unmöglich, da sie keine der beabsichtigten „Endlösungen“ darstellte. Seit etwa 1939 war daher im
Nationalsozialismus, nicht nur parallel zum Krieg, sondern als eines von dessen erklärten Zielen, alles mehr und mehr darauf ausgerichtet, die Juden zu vernichten, ja auszurotten
und zu diesem Zweck sämtliche Mittel, die ihnen das Leben verleideten, von der Schikane bis zum Giftgas, vom Propagandafilm bis zum „gelben Fleck“ des
„Judensterns“, von der gesetzlichen Grundlage bis hin zu den Verbrennungsöfen in den Konzentrationslagern, gutzuheißen, für sinnvoll, angemessen und notwendig zu
bezeichnen und den kaltschnäuzigsten, unbarmherzigsten Antisemiten zur Verfügung zu stellen. Zwar gab es auch hier Ausnahmen, grundsätzlich fielen der rassistischen Politik
des Nationalsozialismus jedoch sowohl Höchstbegabte als auch einfache Menschen ohne jegliche Reputation zum Opfer, denn entscheidend war nichts Geistiges, Schöpferisches
oder Künstlerisches, sondern allein die Verbindung zum Judentum, zu jüdischer Tradition und zu jüdischen Vorfahren, welche als Gefährdung des „gesunden“ Deutschtums
betrachtet wurde. Selbst die Werke lange verstorbener, aber berühmter und vormals häufig aufgeführter Künstler wurden jetzt herabgesetzt, und vom Nationalsozialismus
geprägte promovierte oder habilitierte Musikologen zögerten nicht, Felix Mendelssohn Bartholdy (1808–1847), Jacques Offenbach (1819 bis 1880), Gustav Mahler
(1860–1911) oder Arnold Schönberg (1874–1951), um auch hier nur die heute Berühmtesten zu nennen, zu verunglimpfen und ihr Werk in den Schmutz zu treten.
Das am besten dokumentierte Konzert, in dem Heinz Fischer mitwirkte, ist derzeit jenes
Konzert vom 15. November 1929, welches am Ende dieses Kapitels in einem eigenen Abschnitt behandelt wird (siehe unten).
Hinzu kommen Besprechungen von drei Klavierabenden Heinz Fischers aus dem Berliner Konzertleben, die 1929, 1930 und 1931 in der Allgemeinen Musikzeitung erschienen.
Fischer spielte hier jeweils ein überwiegend gängiges Repertoire, darunter Bach, Mozart, Schubert (Klaviersonate in B-Dur), Schumann (Kreisleriana), Chopin (H-Moll-Sonate),
Liszt, Saint-Saëns, eine Opern-Paraphrase von Strauß-Godowsky oder einen Marsch aus op. 36 von Wolfgang Jacobi. Die Besprechungen, verfasst von Max Donisch
(1880–1941), Erhart Ermatinger (1900–1966) und Walther Abendroth (1896–1973), wurden zwar immer anerkennender, unterschieden sich indes nicht wesentlich von dem
Tonfall, der in Zeitungskritiken weithin verbreitet ist. [30]
Ein „Hauskonzert bei [Gertrud (nicht Gertrude)] Weil“, Berlin-Charlottenburg, in der
Fasanenstraße 5, fand im Januar 1936 statt (vgl. Inge Lammel, wie Anm. [10], S. 57–58); gespielt wurden Klaviersonaten der jüdischen Komponisten „Wolfgang Jacoby“
[Jacobi] (1894–1972) und Jacob [nicht Arnold] Schönberg (1900 bis 1956). [31] Heinz
Fischer begleitete im Monat darauf auch Kompositionen für Cello von Johann Sebastian Bach, doch ist bei Ankündigungen wie dieser unsicher, ob ein Konzert nicht verschoben
wurde oder überhaupt zustandekam, denn nur eine nachträgliche Besprechung lässt in vielen Fällen darauf schließen, dass es tatsächlich auch stattfand. [32]
Ferner wurde eine Veranstaltung der „Seelischen Winterhilfe“ für Sonnabend, den
11. Dezember 1937 in der Berliner Synagoge in der Lindenstraße angezeigt, von der sich aber ebenfalls keine Besprechung auffinden ließ. Hierzu ist zu bemerken, dass
die Bezeichnung „Seelische Winterhilfe“ ein seinerzeit recht üblicher Begriff für konzertähnliche Veranstaltungen der „Jüdischen Winterhilfe“ war, während „Freude im
Winter!“ (siehe diesen deutlich euphemistischen Begriff am Ende der folgenden Anmerkung) ein zur „Seelischen Winterhilfe“ gehörender Titel einer anderen Reihe von Veranstaltungen war. [33] Ingesamt bleibt hinsichtlich der Konzerte Heinz Fischers manche Frage offen, die erneut die Notwendigkeit weiterer Forschung nahelegen, und
vor allem scheinen mir die Berliner Tageszeitungen untersuchenswert, um Ort und Rahmen dieser Konzerte genauer zu bestimmen.
Weitere Nachträge zu Konzerten Fischers wurden in Teil 2 (hier) angezeigt.
Das Konzert am 15. November 1929
Das eingangs erwähnte Konzert, das die vorliegende Forschung auslöste, ist durch seine
postalisch versandte Einladung, die auch das Programm enthielt, sowie eine Kritik gegenwärtig besser überliefert als alle anderen Auftritte Heinz Fischers und wird daher,
nicht wegen seiner künstlerischen Bedeutung, die sich nur sehr schwer beurteilen lässt, in einem eigenem Abschnitt besprochen.
Es handelte sich bei diesem Konzert um eine Veranstaltung des „Vereins ehemaliger
Hochschüler der staatlichen akademischen Hochschule für Musik in Berlin“, die im ,Roten Saal‘ des „Brüdervereinshauses“ stattfand. [34] Der „Brüderverein zur gegenseitigen Unterstützung mittelloser Mitglieder“ wurde am 1. Januar 1815 gegründet [35] und war zunächst in der Berliner „Neuen Friedrichstraße 35“ (heute in Berlin-Mitte,
siehe hier) ansässig. Später verfügte er über ein eigenes Haus, nämlich das von 1908 bis
1910 erbaute „Brüdervereinshaus“, welches in der „Kurfürstenstraße 115/116“, Ecke Nettelbeckstraße (siehe hier) im Stadtteil Tiergarten stand. [36] Nach 1933 wurde der Verein wegen der jüdischen Herkunft seiner Mitglieder verboten und enteignet. Das Berliner Adreßbuch machte nun die konfessionelle Prägung des Vereins deutlich, indem
es „Jüdischer Brüder-Verein“ schrieb. [37] Ab 1941 war in dem Haus des ehemaligen
Vereins die Dienststelle des von Adolf Eichmann (1906–1962) geleiteten und zum Reichssicherheitshauptamt gehörenden „Judenreferats“ untergebracht (auch „Eichmann-Referat“ genannt, siehe hier), in welchem die „Endlösung der Judenfrage“ verwaltet
wurde (siehe hier). [38] Da der „Brüder-Verein“, in dessen Räumlichkeiten das Konzert
im November 1929 stattfand [38a], in den letzten Jahren seines Bestehens als eigenes Periodikum die Zeitschrift des Brüdervereins veröffentlicht hatte (1925–1933, Jg. 1–8
), wäre eine Ankündigung oder Besprechung des Konzertes hier zwar vorstellbar, doch blieb eine an der „Deutschen Nationalbibliothek“ in Leipzig durchgeführte Durchsicht der
Zeitschrift in dieser Hinsicht erfolglos. [39]
Das Konzert im November 1929 ist insofern bemerkenswert, als eine Einladung zu der
Veranstaltung als Fotokopie im Nachlass der russischen Komponistin Natalie Prawossudowitsch (1899–1988) erhalten ist. [40] Aus diesem Dokument sind unter anderem Datum, Ort und Uhrzeit des Konzertes ersichtlich, doch ebenso die Namen
aller Mitwirkenden, darunter Heinz Fischer. Fischer bot hier nur zeitgenössische Werke dar: Norbert von Hannenheims Suite für Klavier Nr. 5 (Allegro, Adagio molto vivace
[sic; da diese Tempobezeichnungen widersprüchlich sind, fehlt vielleicht in dem Programmblatt ein Gedankenstrich hinter „Adagio“ oder hinter „molto“ sowie eine
versale Schreibung des neuen Satzes], Andante sostenuto, Presto) sowie die Uraufführung der Sonate für Klavier Nr. 13 (Allegro, Andante sostenuto, Allegro
molto), die ebenfalls von Hannenheim als Autor hatte. [41] Auch die übrigen Punkte des
Programms standen ganz unter dem Zeichen von Uraufführungen, doch dürfte die Uraufführung von Hannenheims im Einvernehmen mit dem wie Heinz Fischer in Berlin
ansässigen Komponisten erfolgt sein, und ein Austausch zwischen Komponist und Interpret hinsichtlich Notation und Interpretation ist naheliegend. Dies sind freilich nur
Hinweise allgemeiner Art auf eine zwar wahrscheinliche, aber nicht belegbare Zusammenarbeit, auch wenn eine solche durch Eberhard Preußners Besprechung des
Konzerts eine Bekräftigung erfährt (siehe übernächster Absatz). Die Einladung, die auch den Programmablauf festhielt, verwies hinsichtlich ihres Datums auf die Angabe im
Poststempel, woraus sich nur schließen lässt, dass sie mit der Post versandt wurde. Der eigentliche Einladungstext beginnt mit der etwas veralteten Anrede „P. P.“ (Praemissis
praemittendis [was etwa heißt: unter Vorausschickung der vorauszuschickenden Titel wie Dr., Prof. usw.]).
Nach den beiden Solo-Klavierwerken von Hannenheims, die das Konzert mit der Uraufführung eröffneten, folgten als Uraufführungen die Suite für Bratsche und Klavier
op. 35 von Wolfgang Jacobi (siehe hier), gespielt von Heinz Herbert Scholz, Bratsche, und Egon Siegmund, Klavier [42], die Sonatine für Klavier von Natalie Prawossudowitsch (Heinz Hirschland, Klavier) sowie die Sonate für Klavier op. 47 von Ernst Toch (Hans Erich Riebensahm, Klavier).
Eberhard Preußner (1899–1964; siehe hier) schrieb in seiner Besprechung in der
zweiwöchentlich erscheinenden Deutschen Tonkünstler-Zeitung vom 5. Dezember 1929: „Ueber die Richtigkeit der Interpretation seiner beiden Klavierstücke [gemeint sind
die zwei Werke Norbert von Hannenheims] durch Heinz Fischer bin ich mir nicht klar.“ Preußner nennt die Interpretation daher „verschwommen und undeutlich“, stellt sein Urteil
aber durch den sich anschließenden Satz gleich wieder in Frage: „doch höre ich, daß dies gerade die Absicht und der Wunsch des Autors gewesen sei.“ [43]
Fortsetzung in Teil 2
Anmerkungen zu Teil 1
[1] Im Abschnitt Das Konzert am 15. November 1929 wird auf Einzelheiten dieses
Konzerts näher eingegangen. Vgl. ferner Herbert Henck, Norbert von Hannenheim, Deinstedt: Kompost-Verlag, 2007, S. 218, Tabelle (Buch-Details: hier). Als Quellen wurden benannt: Musik im Exil: Die Schönbergschülerin Natalie Prawossudowitsch, Wien und Bozen: Folio-Verlag, 2003, S. 109–118; hier S. 112.
Ferner Peter Gradenwitz, Arnold Schönberg und seine Meisterschüler. Berlin 1925–1933, Wien: Paul Zsolnay, 1998, S. 213–214; vgl. auch Anm. [26].
[2] Der Eintrag lautet: „Fischer, Heinz. * Berlin 15.2.1903, Pian[ist] — Berlin.“, in: Theophil Stengel und Herbert Gerigk, Lexikon der Juden in der Musik, Berlin:
Bernhard Hahnefeld, 1940, Spalte 69 [Buch-S. 220]; vollständiger Faksimile-Nachdruck des Lexikons im Buch von Eva Weissweiler, Ausgemerzt! Das Lexikon
der Juden in der Musik und seine mörderischen Folgen, Köln: Dittrich-Verlag, 1999, S. (181)–375. Das Vorwort, in welchem zahlreiche Eigenschaften des Lexikon genannt
sind, steht auf S. (5)–9 [Buch-Seite 185–189] und sind auf Seite 9 [S. 189] unterzeichnet: „Berlin, August 1940 | Herbert Gerigk.“ Weissweilers Buch ergänzt die
Informationen zu Heinz Fischer auf S. 394; ihre Anmerkungen 98 und 99 auf Seite 422 beziehen sich auf das Gedenkbuch der Opfer der Verfolgung der Juden unter
der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Deutschland 1933–1945, Koblenz 1986, S. 332 bzw. das Gedenkbuch Berlins der jüdischen Opfer des Nationalsozialismus, Berlin 1995, S. 311; beide Bücher sind bei Weissweiler auf
Seite 432 genauer bezeichnet. Siehe auch Anm. [55] zum Datum der Deportation.
[2a] Vgl. Konrad Kwiet, Schrei, was du kanns[t], Teil II von: Der Weg in den Holocaust, in: Der Spiegel, 38/1988 vom 19.09.1988: „Und sie [die Juden] fanden
manchmal "arische" Freunde und Bekannte, die bereit waren, Besitztümer in Verwahrung zu nehmen.“ (pdf-Ausgabe, S. 148, linke Spalte).
[3] Vgl. Kapitel 5: Deportation und Tod. – Das folgende in diesem Absatz Gesagte
bezieht sich mehr im Allgemeinen auf die jüdische Deportation, deren Kenntnis
in den wichtigsten Punkten mir angebracht erscheint. Über die Verwendung der zurückgelassenen Güter und den Tod der Fischers besitze ich keine Informationen, die
über das Mitgeteilte hinausgehen. Man kann indes nur annehmen, dass es den Fischers ähnlich und kaum besser erging als vielen anderen deportierten Juden, deren Schicksal
zum Teil genauer überliefert ist. Jedenfalls habe ich kein Wissen von Dokumenten erlangt, welche etwa von einem Überleben der Fischers im Anschluss an ihren Transport nach Kulmhof (Anfang Mai 1942) sprechen.
[4] Vgl. die Faksimile-Reproduktion eines mit der Schreibmaschine ausgefertigten
„Abwanderungsbescheides“ vom 29. Mai 1942 bei Rewald (wie Anm. [54], Abs. 2), S. 21–23.
[5] Vgl. zur Versteigerung und dem Verkauf der jüdischen Hinterlassenschaften auch die Informationen über die „Aktion 3“ (Tarnbezeichnung), die im Monat nach der Deportation der Familie Fischer in Kraft trat.
Speziell über diesen Punkt des Unverkäuflichen, zu dem ich Noten in Form von Manuskripten rechnen musste, befragte ich Herrn Thomas Ulbrich (siehe Anm. [47]) fernmündlich im September 2011, doch hatte auch er keinerlei Informationen, selbst nicht
solche, in denen vergleichbare Fälle als Vorbild hätte dienen können.
Fast genau ein Jahr nach der Deportation der Fischer-Familie erfolgte die der
Geschwister Ellen und Margot Epstein, deren Biografie ausführlicher beschrieben ist; vgl. insbesondere die Kapitel 13: Die „Vermögenserklärungen“ und andere Aktenstücke sowie Kapitel 14: Die Deportation und der Tod von Ellen und Margot Epstein.
Die hier mitgeteilten Angaben dürften mit der erforderlichen Modifikation auch auf die Fischers zugetroffen haben.
[6] Zu diesen Aussagen vgl. vor allem die Nachträge. – Das „Deutsche Rundfunkarchiv“
in Frankfurt am Main konnte keine erhaltenen Aufnahmen mit Heinz Fischer nachweisen. (Freundliche Mitteilung von Frau Christiane Poos-Breir, „Stiftung Deutsches
Rundfunkarchiv“, Musikbereich, in einer E-Mail am 24. Oktober 2011.)
[7] In Kapitel 3: Konzerte sind Aufführungen zusammengestellt, die sich nachweisen
ließen. Hinzukommen jedoch die Nachträge.
[8] Vgl. zu Ilse Rewald die bei „YouTube“ eingestellten 16 Filme eines Vortrags beginnend mit http://www.youtube.com/watch?v=rFlFIDxbfp4. Es handelt sich dabei um Aufnahmen, die im Jahre 2006 auch unter http://www.kanalb.org/ veröffentlicht wurden. Ilse Rewald verstarb am 15. Dezember 2005, und diese Filme sind ihr zur
Erinnerung gewidmet. Vgl. zu Ilse Rewalds Erinnerungen an Heinz Fischer ferner Anm. [50] und [54], 2. Absatz sowie die Nachträge sowie das Nachwort.
[9] Vgl. das Kapitel „10.04“ (Heinz Fischer) auf der Webseite Jüdisches Leben
in Pankow. Vom Anbeginn zum Neubeginn unter auf der URL http://de.juedisches
-leben. org/ausstellung.php3?topic_id=10&photo_id=04 [nicht mehr vorhanden, Juni 2014] (Konzeption und Regie: Dr. Inge Lammel), © VVN-BdA Berlin-Pankow e. V. |
1998–2007 (die Webseite benutzt bei „verzaubert[e]“ ggf. das Präsens, doch ist fraglich, ob dieses von der Autorin gewünscht war oder auf einem Fehler beruhte). Sinngemäß
wird das Zitat auch wiedergegeben bei I. Lammel, Jüdische Lebenswege (wie Anm. [10]), S. 58. Siehe im Zusammenhang Ilse Rewalds Text, etwa Mitte.
Das „Musikzimmer“ tritt in Frida Fischers „Vermögenserklärung“ (unterschrieben am 15.
Oktober 1941) insofern wieder in Erscheinung, als hier (auf der oben überklebten Seite [2]) unter dem Vordruck „c) Speisezimmer:“ von ihr handschriftlich ergänzt wurde: „+
[Plus-Zeichen] Musikzimmer“; vgl. hierzu Kapitel 4: Zwangsnamen, Zwangsarbeit und „Vermögenserklärungen“.
[10] Vgl. Inge Lammel, Heinz Fischer, ein Musiker – deportiert nach Lódz, in: Inge Lammel, Jüdische Lebenswege. Ein kulturhistorischer Streifzug durch Pankow und
Niederschönhausen, überarbeitete und erweiterte Neuausgabe in einem Band [vereint die zwei Bücher Jüdisches Leben in Pankow (1993) sowie Jüdische Lebensbilder aus Pankow (1996), beide erschienen in Berlin bei der „Edition Hentrich“; vgl. S. [4] oben,
hg. vom „Förderverein ehemaliges Jüdisches Waisenhaus Pankow e.V.“, von der „Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes und dem Bund der Antifaschisten Pankow
e.V.“, Teetz/Berlin: Hentrich & Hentrich, 2007, S. 57–58 (hier die Reproduktion eines Fotos von Heinz Fischer auf S. 57). Vgl. im selben Buch auch die Seiten 133–135: Familie Fischer. Sabine Rebschläger geht ihrem Schicksal nach, mit Foto des
Hauses in Pankow, Breite Straße 8/9. Die Lehrerin Sabine Rebschläger (geb. am 17. März 1926), auf welche die Recherchen offenbar zurückgehen, starb am 24. September 2006 (vgl. S. [4]: Autoren der Beiträge). – Ferner zu Mitgliedern der
Familie Fischer S. 21, 192, 256 sowie auf S. 270 die letzten drei Einträge der Liste Zum Gedenken der ermordeten oder in den Tod getriebenen jüdischen Bürger Pankows
(S. 267–281). – Das zitierte Buch enthält unter anderem auch einen Beitrag über Peter Gradenwitz (Lebensbilder von Pankower Künstlern, hier der Abschnitt Peter
Gradenwitz: Was ist jüdische Musik? auf S. 56–57), der in seinen letzten Lebensjahren mehrfach über Norbert von Hannenheim schrieb und von dem hierbei
mehrfach wichtige Informationen stammten (siehe auch Anm. [26]).
[11] Die Beschreibung des Fotos, die natürlich ganz unverbindlich ist, hatte ich für
den Fall angelegt, dass alle meine Bemühungen, mit denen ich verschiedenenorts um eine offizielle Internet-Reproduktion des Fotos nachsuchte, scheitern würden.
Bedauerlicherweise war dieser Fall nun eingetreten, doch half mir ein Zufall weiter. Ursprünglich wurde das Foto in dem in Anm. [10] genannten Buch reproduziert (siehe hier). Siehe auch die Nachträge 2015.
[11a] Der Ausdruck „Kartoffelbuddler“ geht nicht auf die nationalsozialistische Zeit
zurück, sondern war schon erheblich früher in Gebrauch. Vgl. Eduard Krause, Vorgeschichtliche Fischereigeräte und neuere Vergleichsstücke. Eine vergleichende Studie als Beitrag des Fischereiwesens, Berlin: Verlag von Gebrüder Borntraeger,
1904, S. 146: hier die Ausdrücke „Kartoffelnbuddeln“ und „Kartoffelbuddler“. (Das Buch wurde von der Bayerischen Staatsbibliothek, München, digitalisiert; siehe hier.)
Auch einige Maler haben sich vor 1933 dieses Themas angenommen, darunter Max Liebermann (1846–1935) und Max Pechstein (1891–1955), um nur die beiden bekanntesten zu nennen.
[12] Dieser Geburtsort, der auch für Heinz Fischers Schwester Lotti gilt, war einer der
im Bundesarchiv Berlin befindlichen „Ergänzungskarten für Angaben über Abstammung und Vorbildung aus der Volkszählung vom 17.05.1939“, die aus dem „Reichssippenamt“ stammten, zu entnehmen; Bestand: R 1509; vgl. Anm. [24]. (Eine Abschrift dieser
Karte, die auch Frida und Lotti Fischer erfasste, wurde mir am 19. September 2011 freundlicherweise von Frau Kristin Hartisch, Bundesarchiv Berlin, zugänglich gemacht.)
Folgende Eintragungen waren ebenfalls dieser Karte zu entnehmen: Bei Heinz Fischer „Reichsarbeitsdienst-Datum: 21. [Oktober] 1941“, bei Frida Fischer: das nahe Datum
23. [Oktober] 1941 sowie bei Lotti Fischer das Datum: 01. [November] 1941. Die genannten Daten liegen damit unmittelbar vor oder selbst eine Woche nach der
Deportation am 24. Oktober 1941. – Aus derselben Karte geht noch hervor, dass alle Großeltern der drei Genannten jüdischer Abkunft waren, und die Enkel daher als
„Volljuden“ galten. Als Literatur-Vermerk trägt die genannte Abschrift den Link http://www.bundesarchiv.de/imperia/md/content/abteilungen/abtr/internet_zu_volkszählung mit _faksimile_-1.pdf, durch den man zu dem Aufsatz von Nicolai N. Zimmermann gelangt: Die Ergänzungskarten für Angaben über Abstammung und Vorbildung der
Volkszählung vom 17. Mai 1939. Zimmermann erfasste hier nicht nur den geschichtlichen Hintergrund oder den Überlieferungszustand der Karten, sondern bildete am Ende auch einen originalen Erfassungsbogen ab.
Ferner gehen Geburtstage und -orte der Mitglieder der Familie Fischer aus ihren
„Vermögenserklärungen“ (Oktober 1941) hervor, die von Frida, Lotti und Heinz Fischer vorliegen; vgl. hier.
[13] Dr. med. Fischer starb, als er im Berliner Bahnhof „Börse“ überfahren wurde (heute
S-Bahnhof „Hackescher Markt“). Besteller der Beisetzung war sein Sohn Heinz. (Freundliche Auskunft von Frau Barbara Welker, „Stiftung Neue Synagoge Berlin“ –
„Centrum Judaicum“, Archiv, in zwei E-Mails am 22. November 2011.) – Vgl. auch Inge Lammel, Jüdische Lebenswege (wie Anm. [10]), S. 58, Ende des vorletzten
Absatzes: „Der Vater war bereits 1927 verstorben, er hatte sich das Leben genommen.“ Eine längere „Gemütskrankheit“ von Dr. Julius Fischer ging jedoch nur aus den zwei
Zeitungen über den Selbstmord als einziger Quelle, die mir vorlag, hervor, und es herrschte ein völliges Stillschweigen darüber, das nicht mit seinem Tode enden sollte.
Dr. Julius Fischer wurde auf dem Jüdischen Friedhof Weißensee (Berlin) am 5. August
1927 unter der Nummer 73791 beerdigt; das Grab mit der Asche des Verstorbenen befindet sich im Grabfeld C 6 in Reihe 34. Diese Auskünfte sowie die Angaben über Dr.
Fischers Lebenszeit sowie seinen Geburts- und Sterbeort teilte mir Herr Thomas Pohl, Jüdischer Friedhof Berlin-Weißensee, am 16. September 2011 in einer E-Mail mit. In
seinen Angaben wurde lediglich „Johannesburg“ geändert zu „Johannisburg“ (in Ostpreußen), da diese Verwechslung zu nahe liegt und der ostpreußische Geburtsort von
Julius Fischer aus den Angaben zu seiner Dissertation im Fach Medizin deutlich hervorgeht; vgl. das Bildzitat in Anm. [21].
Nachträge 19.–21.05. und 21.10.2016
Am nächsten Tag (19.7.) schrieb die Berliner Volks-Zeitung über diesen Suizid: „Selbstmord auf dem Bahnhof Börse.
Ein aufregender Vorfall spielte sich gestern in den ersten Nachmittagsstunden auf dem S t a d t b a h n h o f B ö r s e ab. Ein etwa
vierzigjähriger Mann lief auf dem Bahnsteig hin und her. Als ein Stadtbahnzug einfuhr,
w a r f s i ch d e r U n b e k a n n t e vor die Lokomotive und w u r d e
ü b e r f a h r e n. Er erlitt so schwere Verletzungen – der Kopf wurde ihm buchstäblich
vom Rumpfe getrennt – daß der T o d auf der Stelle eintrat. Ausweispapiere wurden bei dem Toten nicht vorgefunden, so daß die Polizei die Personalien des Selbstmörders
bisher nicht feststellen konnte. Die Leiche wurde nach dem Schauhaus gebracht.“ Quelle (unsigniert): Selbstmord auf dem Bahnhof Börse, in: Berliner Volks-Zeitung, hier: Illustrierte Sport-Zeitung, 75. Jg., Nr. 336, Morgen-Ausgabe, Dienstag, 19. Juli 1927,
S. [2] der Sport-Zeitung, Sp. [3] (unterster Bericht). Siehe auch den unsignierten Beitrag unter der Überschrift: Selbstmord auf dem Bahnhof Börse. Unter den fahrenden Zug geworfen., in: Berliner Stadtblatt. General-Anzeiger des Berliner
Tageblatts, 39. Jg., Nr. 166, Dienstag, den 19. Juli 1927, Titelseite, Sp. [1], zuunterst. (Beilage zu: Berliner Tageblatt und Handels-Zeitung, „Morgen-Ausgabe“, 56. Jg., Nr.
336, „Ausgabe für Berlin“, Berlin: Rudolf Mosse, Dienstag, den 19. Juli 1927.) Die Überschrift ist angepasst; der Artikel lautet fast gleich wie der zu Beginn bereits zitierte aus der Berliner Volks-Zeitung (s. o.) von demselben Tag, auch „Morgen-Ausgabe“. –
Bei dem hier genannten sich selbst tötenden Mann handelte es sich vermutlich um Dr. med. Julius Fischer, der zwar 1864 geboren war, der jedoch am selben Tag und am
selben Ort auf dieselbe Weise Suizid begangen haben müsste.
Bestätigen ließen sich Artikel wie Vermutung durch die Deutsche Allgemeine Zeitung (66. Jg., Nr. 332, Ausgabe für Groß-Berlin, Dienstag Abend, Berlin, 19. Juli 1927,
S. [3], Sp. [5]). Dieser Artikel berichtet kürzer, letztlich jedoch mehrsagend von der Identität des Toten. Die Überschrift lautete hier: „Selbstmord auf den Schienen“. Des
Weiteren heißt es: „Auf dem B a h n h o f B ö r s e warf sich ein Mann vor einen
einfahrenden Stadtbahnzug und wurde überfahren. Der Lebensmüde war auf der Stelle
tot. Er ist jetzt festgestellt als ein S a n i t ä t s r a t Dr. F., der in einem Berliner Vorort
wohnte und schon längere Zeit g e m ü t s k r a n k war.“
Auf derselben Quelle wie die zitierte Zeitung (DAZ) dürfte der folgende Bericht beruhen (Teil: Aus Groß-Berlin), dessen Titel ist:
Selbstmord eines Sanitätsrates. Er wurde abgedruckt in der Berliner Börsen-Zeitung, Abendausgabe, 73. Jg., Nr. 332, Dienstag,
19. Juli 1927, S. 3, Sp. [1]. Die Angaben stammten wohl aus einer amtlichen Mitteilung und werden, da sie fast gleichlautend sind, hier nicht wiederholt. Alle Zeitungsartikel, die
über den Vorfall berichteten und mir zu Gesicht kamen, waren ohne Signatur.
Da der Titel „Sanitätsrat“ somit einen weiteren Hinweis auf die Identität des Toten
erbrachte, ging ich ihm nochmals nach, was zur Entdeckung einer neuen Quelle führte (Anm. [22], hinter dem Asterisk).
*
Eine private Todesanzeige erschien im Berliner Tageblatt am Sonntag, den 24. Juli 1927 und lautete:
„Mein lieber Mann, unser herzensgütiger Vater, | Sanitätsrat | Dr. Julius Fischer | ist nach schwerem, qualvollem Leiden von uns | gegangen. | Pankow, Breite Strasse 8-9. |
In tiefem Schmerz | Frau Frida Fischer | mit ihren Kindern Lotti und Heinz. | Die Einäscherung hat in aller Stille statt- | gefunden. | Beileidsbesuche dankend verbeten.“
Berliner Tageblatt und Handels-Zeitung, 56. Jg., Nr. 346, Berlin: Rudolf Mosse, Sonntag, den 24. Juli 1927, Morgen-Ausgabe, S. [10], untere Hälfte (2. Beiblatt,
„Familien-Anzeigen“).
*
[14] Vgl. Berliner Adreßbuch 1891, Theil V, S. 93, Sp. [1] (Online-Ausgabe); hier
lautete die Adresse noch „Schloßstr. 9“ in Pankow – vgl. im selben Band S. 98, Sp. [3] (Online-Ausgabe) –, doch ist es nach systematischer Durchsicht der Berliner Adreßbücher wenig wahrscheinlich, dass eine Verwechslung mit einer gleichnamigen
Person stattfand. Ein vergleichbarer Eintrag fehlt indes noch im Vorjahr, sowohl im allgemeinen Einwohnerverzeichnis von Berlin sowie im Einwohnerverzeichnis oder der
„Schloßstraße 9“ von Pankow (ebd., S. 89, Sp. [3]). Man kann daher annehmen, dass Fischer erst 1890 oder 1891 in Pankow zuzog.
Dass der Geburtsort von Dr. med. Julius Fischer Johannisburg in Ostpreußen (heute Pisz
in Polen), ging eindeutig aus dem Eintrag zu seiner Dissertation hervor; vgl. Anmerkung [21]. – Vgl. auch Ulf H[ans] W[erner] Wöbcke, Johannisburg in Ostpreußen.
Straßen, Gebäude, Landschaft und Menschen mit Geschichte und Einwohnerverzeichnis um 1900 bis 1945, Entstanden aus den Informationen
ehemaliger Johannisburger, Herausgeber: Kreisgemeinschaft Johannisburg e. V., Barmstedt 2008, 680 Seiten (http://www.johannisburg-ostpreussen.de.vu/); pdf-Datei
mit Übersicht unter http://www.kreis-johannisburg.de/Stadt/Johannisburg/PDF/Buch-Jo-Musterseiten.pdf.
[15] Dr. med. Julius Fischer erschien letztmalig im Berliner Adreßbuch 1928; im Jahr
darauf verwies bei seiner Frau, Frida Fischer, die Abkürzung „Ww.“ (Witwe) auf den Tod des Arztes und Ehemanns; vgl. Jg. 1928, Teil I, S. 756, Sp. [1] (Online-Ausgabe) sowie Jg. 1929, Teil I, S. 776, Sp. [4], achtletzter Name der Seite (Online-Ausgabe). – Auch in der „Vermögenserklärung“ von Frida Fischer erscheint auf der ersten
ausgefüllten Seite unter dem Vordruck „Familienstand“ die Angabe „verwitwet“, die als einzige nicht durchgestrichen ist.
Zu den Eigentumsverhältnissen des Hauses, in dem Dr. Julius Fischer praktizierte und wohnte, vgl. Anm. [44] sowie den in Anm. [45] belegten Haupttext.
[16] Lebensdaten nach der Webseite (Webseite nicht mehr vorhanden, Juni 2014).
[17] Sabine Rebschläger im Buch von Inge Lammel (wie Anm. [10]), S. 133–134.
Zur Hadlichstraße, die dem Arzt und Vorsitzenden des Bürgervereins gewidmet ist, vgl. den Eintrag in der Wikipedia hier. Vgl. hierzu auch Anm. [23].
[18] Inge Lammel (wie Anm. [10]), S. 57. Vgl. auch Anm. [23] (erster Absatz) mit den
Informationen aus dem Nürnberger Stadtarchiv über Frida Fränkels Herkunft. Ob es verwandtschaftliche Bindungen von Frida Fränkel und dem Architekten Joseph Fränkel
gibt, ist mir nicht bekannt; zwar wäre es möglich, doch ist der Familienname Fränkel ist sehr verbreitet.
[19] Vgl. Berliner Adreßbuch 1891, Teil V, S. 93, Sp. [1], zehnter Eintrag von oben
unter „Fischer“ mit der Anschrift Pankow, Schloßstr. 9. – Da in diesem Verzeichnis unter derselben Adresse und im selben Stockwerk auch eine „Kaufmannswitwe“ namens
„Fischer, J. geb. Samelsohn“ [sic] wohnte, handelte es sich möglicherweise um eine Anverwandte. Bestärkt wird diese Ansicht durch den Umstand, dass beide Namen noch
im vorausgehenden Adreßbuch (1890) an dieser Stelle fehlten.
[20] Die Koloquinte ist eine medizinisch genutzte Pflanze; siehe hier.
[21] Vgl. das Jahres-Verzeichniss der an den Deutschen Universitäten erschienenen Schriften, [Teil] V [= römisch 5] ([Erfassungszeitraum:] 15. August 1889 bis 14. August
1890), Berlin: Verlag von A. Asher & Co., 1890, S. 6 (Berlin 1889–90), Nr. 42:
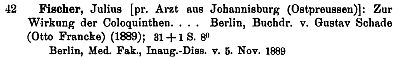
Bildzitat nach der Online-Ausgabe. Das Buch wurde wohl irrtümlich ohne Jahresangabe
im Internet aufgenommen („n.d.“ = no date, ohne Datum), doch ist auf dem Titelblatt der reproduzierten Ausgabe deutlich das Erscheinungsjahr „1890“ zu lesen).
[22] Zum Titel „Sanitätsrat“ den Link http://de.wikipedia.org/wiki/Sanit%C3%A4ts rat# Preu.C3.9Fen, wobei die Regelung in Preußen die zutreffende ist. Vgl. zum Titel von Dr. med. Fischer das Berliner Adreßbuch 1915, Teil V, S. 234, Sp. [2] unter Breite
Straße 8.9 in Berlin=Pankow (Online-Ausgabe). Eine zwanzigjährige Tätigkeit als Arzt
scheint erfüllt gewesen zu sein, da sich an die Dissertation zunächst mindestens vier Jahre zur Weiterbildung an einer Klinik anzuschließen hatten, bevor eine Niederlassung als „Praktischer Arzt“ möglich war. Durch diese Voraussetzung kommt man auf etwa 1913
oder 1914 als Zeitpunkt der Zuerkennung des Sanitätsrat-Titels, der etwas verzögert, vielleicht als Folge des Ersten Weltkriegs, im Berliner Adreßbuch 1915 erschien.
*
Im Mai 2016 ließ sich der Fall jedoch klären durch eine Webseite, die unter der URL http://www.mehrow.de/Presse_und_Literatur/NiederbarnimerKreisblatt/NB_Kreisblatt_1914.html aufrufbar war.
Ein Abschnitt dieser Webseite besagte:
„Sonntag, den 1. Februar 1914 (Nr. 27), Amtlicher Teil [1]
Bekanntmachung.
Seine Majestät der Kaiser und König [Wilhelm II.] haben Allergnädigst geruht,
den Aerzten Dr. Paul Crusius in Altlandsberg und Dr. Julius Fischer in Berlin-Pankow den Charakter als Sanitätsrat zu verleihen.
Berlin, den 28. Januar 1914.
Der Landrat, Dr. Busch.“
Die hochgestellte Anmerkung hinter „Amtlicher Teil“ (über dem Zitat) verweist auf eine Ergänzung aus dem Stadtarchiv Bernau im Juni 2015.
„Charakter“ ist hier die heute nicht mehr gebräuchliche Bezeichnung für „Titel, Rang“.
Einige der genannten Ortschaften schließen sich unmittelbar an Berlin an und gehören heute zum
Teil zu der deutschen Hauptstadt. Sie alle liegen aber nicht fern von Berlin.
Als Kontaktperson ist der Orts-Chronist Herr Benedikt Eckelt, Mehrow, mit einer eigenen E-Mail-
Adresse auf der oben schon erwähnten Webseite (ganz unten, links) benannt.
[23] Eine Anfrage im Stadtarchiv der Stadt Nürnberg bestätigte unter anderem dieses
Datum, das auch auf der allerersten Seite von Frida Fischers „Vermögenserklärung“
erscheint, denn ich erhielt am 5. September 2011 die schriftliche Auskunft: „[…] folgende Angaben waren aus der Einwohnermelde-Überlieferung (Quellen: C 21/X Nr.
2 & 3) über Fri(e)da Fischer, geb. Fränkel (geb. 22.02.1877 in Nürnberg), zu ermitteln: Sie war die Tochter des Kaufmanns Julius [Fränkel] (geb. 19.12.1849 in Diespeck
[etwa 37 km westlich von Erlangen], gest. 29.12.1914 in Nürnberg) und seiner Frau Ida, geb. Bettmann (geb. 12.07.1854 in Gereuth), und hatte einen jüngeren Bruder Alfred
(geb. 17.01.1882 in Nürnberg). Die Witwe Ida Fränkel zog am 18.07.1939 nach Berlin-Pankow, vermutlich zu ihrer dort lebenden Tochter (s. u.). Über ihr weiteres Schicksal
ist nichts bekannt; sie erscheint auch nicht im Bundesgedenkbuch für die deutschen Opfer der Shoah. Am gleichen Tag verließ Alfred Fränkel mit seiner Familie Nürnberg mit dem
Ziel Coventry (England). [Absatz] Fri(e)da [Fischer] besuchte das letzte Mal Nürnberg zwischen dem 25. und 28.06.1941. Von hier meldete sie sich nach Pankow, Breite
Straße 8, ab.“ (Herrn Gerhard Jochem, Stadtarchiv Nürnberg, Forschungsschwerpunkt jüdische Geschichte, ist vielmals zu danken für seine detaillierten Nachforschungen.) –
Vermutlich ist der hier genannte Besuch gemeint, da Sabine Rebschläger schreibt: „Kurz vor Kriegsausbruch kamen noch einmal die Verwandten von Frau Fischer zu Besuch, um
sie von der Notwendigkeit des Auswanderns zu überzeugen.“; vgl. in: I. Lammel (wie Anmerkung [10]), S. 135.
Unter den wenigen Büchern, die Fri(e)da Fischer noch nannten, war das JÜDISCHE ADRESSBUCH FÜR GROSS-BERLIN, Ausgabe 1931, Gültig bis Mitte 1932, Berlin:
GOEDEGA-VERLAGSGESELLSCHAFT M. B. H., Vorwort am Schluss datiert: „Berlin, im Juni 1931“, in dem „Fischer, Frieda, Pankow, Breite Straße 8/9“ auf S. 95,
Spalte [3], 9. Name von unten, verzeichnet wurde (Online-Ausgabe, hier 213:95).
Möglicherweise hatte Ida Fränkel, deren Zu- und Vorname vielleicht maßgeblich für die
Schreibweise ihrer Tochter wurden (Fr[änkel]Ida = Frida), noch eine Verwandte mit demselben Familiennamen, da das Gedenkbuch (vgl. Anm. [56]) eine Pauline
Bettmann (geb. am 4. Mai 1852 in Gereuth, wohnhaft u. a. in Nürnberg) angibt, die von Nürnberg aus am 10. September 1942 nach Theresienstadt in das „Altersghetto“
deportiert wurde; vgl. Gottwaldt und Schulle (wie Anm. [56], S. 453). Ihren Todestag gibt das Gedenkbuch mit 19. September 1942 in Theresienstadt an (siehe hier).
Derselbe Nachname (Bettmann), die Nähe der Geburtstage (4.5.1852 [Pauline] bzw. 12.7.1854 [Ida]), die Glaubenszugehörigkeit (Jüdin) sowie der Geburtsort (Gereuth)
stimmen jedoch überein, so dass eine verwandtschaftliche Beziehung naheliegt. Ida Fränkel, die offenbar 1939 nach Berlin zu ihrer Tochter zog, wird im Adressbuch von
Berlin nicht genannt. Möglicherweise handelte es sich aber nur um einen längeren Besuch in Berlin, der von S. Rebschläger genannt wird; vgl. das Zitat am Ende des vorvorigen Absatzes.
Auffällt ferner, dass Frida sowie Lotti und Heinz Fischer jeweils Vornamen aus nur fünf
Buchstaben trugen, wodurch auch hier ein gewisses Zahlenspiel erkennbar wird, zumal die Zunamen Fischer bzw. Fränkel beide mit F beginnen und aus sieben Buchstaben
zusammengesetzt sind, deren vorletzter ein „e“ ist. Hierbei jedoch von einer Form der Kabbalistik zu sprechen, schiene mir freilich übertrieben, solange nicht eindeutigere Hinweise vorliegen.
[24] Vgl. Anm. [12]. – Bei Lotti Fischer lautet die Ergänzung auf der Karte
„Reichsarbeitsdienst-Datum: 01.11.1941“. Zu diesem Zeitpunkt müsste Lotti Fischer freilich längst in Litzmannstadt gewesen sein, da sie wie ihre Mutter und ihr Bruder am
24. Oktober 1941 aus Berlin deportiert wurde. Möglich ist natürlich, dass eine Arbeit, die zwangsweise in Litzmannstadt zu verrichten war, damals als „Reichsarbeitsdienst“
eingestuft wurde. – Lotti Fischer blieb den vorliegenden Quellen zufolge unverheiratet, da sie unter ihrem Mädchennamen noch in dem Berliner Adreßbuch 1941 erschien (vgl. das Ende von Anm. [44] sowie Anm [45]); dem entspricht, dass sie, wie ihr Bruder Heinz, in ihrer „Vermögenserklärung“ (17.10.1941) als Familienstand einzig „ledig“ nicht strich.
[25] Siehe Rebschläger in: I. Lammel, Jüdische Lebenswege (wie Anm. [10]), S. 134
mit Foto: „Wohnhaus der Familie Fischer in der Breite Straße 8/9“. – Der Garten kommt bei Rebschläger auf S. 133 zur Sprache, ferner am Ende von Anm. [50]. Zu der Bezeichnung „Morgengabe“ und diesem Brauchtum siehe den gleichnamigen Artikel der Wikipedia (hier).
[26] Peter Gradenwitz (1910–2001) bezeichnete im von-Hannenheim-Kapitel
seines Buchs über Schönbergs Meisterschüler Heinz Fischer als „brillante[n], vielversprechende[n] Pianist“ (wie Anm. [1], S. 214). Da jedoch kein historisches
Schriftstück eines solchen Inhalts nachgewiesen ist, die von Fischer aufgeführte Sonate von Hannenheims meines Wissens verschollen ist und von Fischers Klavierspiel keine
Tonaufnahme zu existieren scheint, entspringen diese Attribute wohl eher einer persönlichen Wertung der Forschers, als dass es sich hier um eine geschichtliche
Überlieferung handelt. Gleichwohl sei nicht vergessen, dass ohne die Forschungen von Gradenwitz der Zusammenhang von Heinz Fischer und Norbert von Hannenheim wohl
noch länger unbemerkt geblieben wäre, so dass vorliegende Forschungen letztlich von Gradenwitz’ Arbeit ausgehen. Dieses trifft auch zu, obwohl von Hannenheim nicht in dem Buch Lammels (wie Anmerkung [10]) erwähnt wird, welches trotzdem die bislang ausführlichste Übersicht über Leben und Arbeit des Pianisten Heinz Fischer enthält.
[27] Vgl. Artikel Zeelander, Godfried, in: Lexikon der Juden in der Musik (wie Anm. [2]), Sp. 300 des Faksimile-Nachdrucks bzw. S. 335 in dem gesamten Buch. Hiernach
wurde Zeelander am 9. Januar 1887 in Amsterdam geboren, war später Orchestermusiker und lebte in Berlin. Zeelanders Todestag ist der 10. September 1942:
er kam wahrscheinlich im Rahmen der Judenverfolgung und -ausrottung in Auschwitz in einem Vernichtungslager ums Leben. Vgl. die „Suche“ im Namensverzeichnis in: Gedenkbuch für die Opfer der NS-Judenverfolgung in Deutschland, im Internet seit
Dezember 2007, siehe hier, online Fassung.
Siehe auch Berliner Musik=Jahrbuch 1926, im Verzeichnis Adressen Berliner Tonkünstler, erstellt von Dr. Walter Grube, den Eintrag auf S. 191 unter dem Cellisten:
„Zeelander, Gottfr[ied] Konz[ert-] M[eister], Wilm[ersdorf], Düsseldorfer Str. 47, [Telefon:] Oliva 3640.“ Zeelander hatte zusammen mit dem Geiger Boris Schwarz und
dem Pianisten Joseph Schwarz ein Klaviertrio gegründet, welches mehrfach in den Veranstaltungen des „Jüdischen Kulturbunds“ auftrat. Zeelander wurde (in der Quelle)
als Solocellist bezeichnet, der unter Furtwängler gearbeitet hatte. Vgl. auch hier zu
Zeelander; von der angegebenen Webseite aus sind zwei Dokumente im pdf-Format als Download zugänglich, welche die finanziellen Möglichkeiten Zeelanders nach seiner
Entlassung in Berlin (1933) zum Gegenstand haben (jeweils Suche unter „meer“ [mehr]). Zwar wird das Konzert mit Heinz Fischer hier nicht angesprochen, doch sind die
Dokumente als solche und der Hinweis auf Auftritte im „Jüdischen Kulturbund“ bezeichnend.
Siehe auch den Aufsatz über Ellen Epstein mit Suchfunktion, Teil 1, mit Anm. [51a].
[28] Vgl. das in Anm. [9] belegte Zitat von Ilse Rewald.
[29] Über seine Tätigkeit als Hilfsarbeiter in einem Malereigeschäft schreibt Fischer
selbst in seiner „Vermögenserklärung“; vgl. hierzu Anm. [49] sowie den Haupttext in Kapitel 4. Zu seiner Heranziehung bei der Kartoffelernte vgl. Anm. [50].
[30] Die drei Besprechungen sind: Max Donisch, [Rubrik Aus dem Berliner Musikleben], in: Allgemeine Musikzeitung, hg. von Paul Schwers, 56. Jg., Nr. 13,
Berlin, 29. März 1929, S. 355, linke Spalte. – Erhart Ermatinger, [Rubrik Aus dem Berliner Musikleben], in: Allgemeine Musikzeitung, hg. von Paul Schwers, 57. Jg., Nr.
11, Berlin, 14. März 1930, S. 260, rechte Spalte. – Walther Abendroth, [Rubrik Aus dem Berliner Musikleben], in: Allgemeine Musikzeitung, hg. von Paul Schwers,
58. Jg., Nr. 13, Berlin, 27. März 1931, S. 245, linke Spalte. Vielleicht sind in der Berliner Lokalpresse noch weitere Rezensionen dieser Aufführungen Fischers zu finden,
deren Ort und genauer Zeitpunkt jedoch nicht aus den genannten Quellen hervorgehen. Vgl. auch in den Nachträgen 2015 und 2016 die Konzerte, die Fischer im Rahmen
seines Studiums gab (Unterkapitel: Studium und Repertoire Fischers).
[31] Siehe: Jascha Nemtsov, Der Zionismus in der Musik, Wiesbaden: Otto
Harrassowitz GmbH & Co. KG, 2009, Reihe: Jüdische Musik und nationale Idee, Band 6, Seite 266 (Online-Teilausgabe). Aus dieser Quelle geht auch das außergewöhnliche Engagement von Gertrud Weil hervor, die in Berlin bis zum April 1938
über einhundert Konzerte veranstaltete; hierbei fand der Komponist Jakob Schönberg besondere Berücksichtigung. Vgl. auch Ludwig Misch, Kompositionen von Jacob Schönberg unter der Hauptüberschrift Berichte und Referate, in: Gemeindeblatt der
Jüdischen Gemeinde zu Berlin, 26. Jg., Nr. 17, Berlin, 26. April 1936, S. 6, mittlere Spalte (Online-Ausgabe).
[32] Verweis von I. Lammel, Jüdische Lebenswege (wie Anm. [10]), Seite 58
in Fußnote 1 auf das Buch Geschlossene Vorstellung. Der jüdische Kulturbund in Deutschland 1933–1941, Berlin: Hentrich, 1992, S. 441 [lag nicht vor]).
Möglicherweise ist hier jenes Konzert gemeint, in dem Heinz Fischer den Cellisten Godfried Zeelander begleitete, welcher einst Solocellist der Berliner Philharmoniker gewesen war (vgl. Anm. [27]). Das Konzert sollte am 1. Februar 1936 bei [Gertrud]
Weil stattfinden, wie der Veranstaltungskalender des Jüdischen Gemeindeblatts vom 26. Januar 1936 ankündigte. Es handelte sich um eine „Kulturelle Veranstaltung bei
Weil“ in der Fasanenstraße 5. Welche Stücke hierbei dargeboten wurde, wurde aber nicht gesagt. Vgl. das Gemeindeblatt der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, 26. Jg.,
Nr. 4, Berlin, 26. Januar 1936, S. 16, Sp. [3] (Online-Ausgabe in der Datenbank Jüdische Zeitschriften in NS-Deutschland).
[33] Die drei folgenden unsignierten Artikel, die im Wesentlichen denselben Inhalt haben,
dienten als Vorschau. Das Programm der Veranstaltung, das unter Mitwirkung des „Orchesters der Künstlerhilfe“ (Leitung Werner Fabian) aufgeführt wurde, ist nicht
genannt, doch ist „Heinz Fischer (Klavier)“ in allen drei Fällen namentlich aufgeführt: (a) Abschnitt Seelische Winterhilfe unter der Überschrift Jüdische Winterhilfe der
Jüdischen Gemeinde zu Berlin, in: C.V.-Zeitung. Allgemeine Zeitung des Judentums, 16. Jg., Nr. 48, Berlin, 2. Dezember 1937, S. 16, Sp. [1]–[2] (Online-Ausgabe bei Compact Memory); (b) erster Eintrag unter der Überschrift „Seelische Winterhilfe“ in der Wochenzeitung Jüdisches Gemeindeblatt für Berlin, 27. Jg., Nr. 49, Berlin, 5.
Dezember 1937, S. 8, Sp. [1]; (c) der Abschnitt Freude im Winter! unter der Überschrift Die Jüdische Winterhilfe Berlin teilt mit, in: Das jüdische Volk, 1. Jg., Nr.
24, Berlin, 10. Dezember 1937, S. 8, Sp. [2] (letztere zwei Quellen als Online-Ausgaben in der Datenbank Jüdische Zeitschriften in NS-Deutschland).
[34] Vgl. Gradenwitz (wie Anm. [1]), S. 213. Vgl. auch die Webseite des Prawossudowitsch-Archivs, in dem nur der Pianist Heinz Hirschland (geb. 1901 in
Frankfurt am Main), nicht aber Heinz Fischer genannt wird. Hirschland wird im selben Buch von Gradenwitz auf S. 255 im Kapitel über Natialie Prawussodowitsch (S.
247–257) erwähnt; der „Rote Saal“ des Brüdervereinshauses als Ort des Konzertes erscheint nur bei Gradenwitz, S. 213. (Die Einladung wurde mir freundlicherweise von
dem Archivleiter Herrn Dr. Werner Grünzweig Ende September 2011 zugänglich gemacht; Akademie der Künste, Berlin, Musikarchiv.) Aus diesem Dokument ist zu
ersehen, dass der „Rote Saal“ des „Brüdervereinshaus“ als Ort der Veranstaltung sowie die Berliner Adresse mit Schreibmaschine in den freien Raum zwischen den Zeilen in den
Druck geschrieben war, und so lautete der ursprüngliche Ort der Veranstaltung, der
mit „=“-Zeichen übertippt, aber noch lesbar ist: „Roswitha-Saal Lützowplatz 8“ in Berlin-Tiergarten. (Kleine Schreibfehler der Einladung wurden stillschweigend berichtigt.)
Der Beginn der Konzertes, der auf „abends 8.15 Uhr“ festgesetzt war, blieb unverändert. Dem Berliner Adreßbuch 1929 zufolge befand sich unter der ursprünglichen Adresse
„Lützow-Platz 8“ der „Deutsche Lyceum-Club e.V.“ (T. IV, Seite 633, Sp. [3]; Onlineausgabe), der nur etwa 400 m von der späteren Konzert-Adresse entfernt war.
Ein Grund für die Verlegung der Veranstaltung ist nicht angegeben, doch kann man vielleicht annehmen, dass die Zusammensetzung des Programms und seiner Spieler zu
wenig den Richtlinien des „Lyceum-Clubs“ entsprach, der gemäß seiner Satzung eine Vereinigung „von und für Frauen“ war.
[35] Vgl. den folgenden Permalink: http://stabikat.sbb.spk-berlin.de:8080/DB=1/ XMLPRS=N/PPN?PPN=41886022X
[36] Bereits im Berliner Adreßbuch 1911 (Teil III, S. 468) ist in Sp. [5] ein Eintrag
unter „Kurfürstenstraße 115.116“ zum „Brüder-Verein“ vorhanden (Onlineausgabe). –
Die Nettelbeckstraße gehörte von 1885 bis 1938 zu Berlin-Charlottenburg und heißt seit November 1962 bis heute „An der Urania“ (Berlin-Schöneberg).
[37] Vgl. das Berliner Adreßbuch von 1940, Teil IV, S. 1585, Sp. [1] unter
„Kurfürstenstraße 115.116“ (Schöneberg) den Eintrag: „Jüdischer Brüder-Verein zu gegens[eitiger] Unterstützung“. Im selben Adressbuch von 1943 heißt es freilich in
Teil IV, S. 1585, Sp. [2] unter derselben Adresse: „Reichsvereinigung d[er] Juden i[n] Deutschl[and] (Kantstr. 158)“. In der „Kantstraße 158“ (Charlottenburg) begegnet man
jedoch beim Folgen des Verweises nicht dem gesuchten „Jüdischen Brüder-Verein“, sondern, neben normalen Berufen, Mietsräumen des „Reichsminist[eriums] f[ür] d[ie] bes[etzten] Ostgebiete.“ (Berliner Adreßbuch 1943, Teil IV, S. 1077, Sp. [5]; Onlineausgabe).
Zur „Reichsvereinigung der Juden“ sowie der Zwangsmitgliedschaft für Juden (gegründet am 4. Juli 1939, aufgelöst am 10. Juni 1943) vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Reichsvereinigung_der_Juden_in_Deutschland.
[38] Vgl. Avraham Barkai, Oskar Wassermann und die Deutsche Bank. Bankier in schwierigen Zeiten, München: C. H. Beck, 2005, S. 129, Anmerkungen III, 4
(Online-Teilausgabe). Vgl. in der Aktion „Mahnort“ die Bushaltestelle 3 (siehe hier).
[38a] Siehe die Abbildung bei Gottwaldt und Schulle in Anm. [55a], ganz am Ende.
[39] Vgl. den Permalink http://gso.gbv.de/DB=2.226/PPNSET?PPN=532657136.
(Eine briefliche Mitteilung erhielt ich am 15. September 2011 aus der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig von der Sachgebietsleiterin Frau Annette Nase im Auftrag
von Frau Steffi Wolf, denen beiden für die Recherche in dem für die Fernleihe nicht freigegebenen Periodikum gedankt sei.)
[40] Vgl. Anm. [34].
[41] Von diesem Programm als Quelle ausgehend schloss ich in meinem Buch über von Hannenheim (siehe Anm. [1]), dass vor der Uraufführung von Hannenheims Klaviersonate Nr. 13 im November 1929 alle der nur zum Teil überlieferten
Klaviersonaten Nr. 1 bis 12 „spätestens 1929“ komponiert sein müssten, da es zumindest unüblich wäre, eine der niedrigeren Nummern zu überspringen oder auf spätere Zeit zu verschieben.
[42] Der Pianist Egon Siegmund (1906–1942) stammte wie Norbert von Hannenheim aus Siebenbürgen; vgl. Egon Hajek, Die Musik. Ihre Gestalter und Verkünder in
Siebenbürgen einst und jetzt, hg. von Heinrich Zillich, Kronstadt: Klingsor-Verlag, 1927, Reihe: Siebenbürgische Kunstbücher, II. Bd., S. 113, wo Siegmund gleich nach
der Pianistin Luise Gmeiner genannt wird (vgl. die Online-Ausgabe des Berliner Adreßbuchs 1929, Teil I, S. 978, Sp. [3] für „Gmeiner, Luise“ sowie die Online-Ausgabe von Teil I, S. 3437, Sp. [1] für „Siegmund, Egon“). Auch in dem Berliner
Musik=Jahrbuch 1926, das in Berlin und Leipzig in der „Verlagsanstalt Deutscher Tonkünstler A.-G.“ erschien und von Arnold Ebel herausgegeben wurde, ist Siegmund
auf S. 162 („Klavier und Orgel“ – „Herren“) vertreten, wo er unter derselben Adresse wie 1929 wohnte.
[43] Eberhard Preußner (Berlin), Musikpolitische Zeitschau [DTZ-Berichte], in: Deutsche Tonkünstler-Zeitung. Offizielles Blatt des „Reichsverbandes Deutscher
Tonkünstler und Musiklehrer e. V.“, Hauptschriftleiter: Arnold Ebel (Berlin), 27. Jg.,
Nr. 512, Mainz: Verlagsanstalt Deutscher Tonkünstler, Heft 23, 5. Dezember 1929,
S. 735–736; hier die Konzertrezension auf S. 736, beginnend mit dem letzten Absatz der linken Spalte.
Fortsetzung in Teil 2
Erste Eingabe ins Internet: Montag, 13. Februar 2012
Letzte Änderung: Donnerstag, 10. November 2016
© 2012–2016 by Herbert Henck
|

