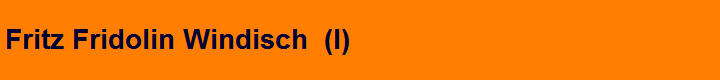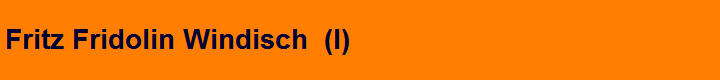|
Fritz Fridolin Windisch
1895–1961
Teil 1
von
Herbert Henck
Teil 1
Kap. 1 Die Zeitschrift Melos als Ausgangspunkt
Kap. 2 Drei Lebensläufe (I–III)
Kap. 3 Erster Weltkrieg, Reifeprüfung, Studium in Leipzig und Berlin
Erster Weltkrieg und Reifeprüfung
Studium in Leipzig
Studium in Berlin
Promotion und Habilitation
Kap. 4 Familiäre Verhältnisse
Anmerkungen zu Teil 1
Teil 2
Kap. 5 Literarisches und „Neuendorff & Moll“
Kap. 6 Musik
Lehrer
Kompositionen
Die Widmung von Ludwig Weber
„Melos“
Der Name „Melos“
Windischs „Melos“-Korrespondenz
Windischs eigene Aufsätze in Melos (1920–1922)
Der „Melos-Verlag“
Die „Melos-Gemeinschaft“ in Berlin und Leipzig
Herbert Graf
Ein Skandal und sein Nachspiel in der Weltbühne
Anmerkungen zu Teil 2
Teil 3
Kap. 7 Ergänzungen aus Fritz Windischs Nachlass (FWN)
Der Prozess (1934)
Die Institutsgründung
Der Lebenslauf IV von Windisch
Editorische Vorbemerkung
Windischs Lebenslauf IV (Text)
Aufenthalt in Schlitz. Briefe 1945–1947
Kap. 8 Chronologie
Anmerkungen zu Teil 3
Dank
Abbildungen
Abb. 1 Fritz Windisch (Foto, spätestens 1960)
Abb. 2 Dokument der Entziehung von Windischs Lehrbefugnis (1. Juni 1935)
Abb. 3 Fritz Windisch (Foto, 1914)
Abb. 4 Fritz Windisch (Zeichnung, 1917)
Abb. 5 Mitteilungszettel des Melos-Verlags (1. April 1921)
Abb. 6 Kammermusik-Veranstaltungen der Melos-Gemeinschaft 1921/1922
Abb. 7 Musikblätter, herausgegeben von Herbert Graf (Briefkopf)
Abb. 8 Herbert Graf (Porträtfoto)
Abb. 9 Fritz Windisch in dem Institut für Brauerei und Mälzerei, spät. 1935
Ausführlichere Informationen über folgende Personen
Francke, Richard (Komponist)
Graf, Herbert (Bankprokurist, Melos-Förderer, Musikschriftsteller)
Simon, Dr. James (prom. Pianist)
Venus, Hugo (Geiger)
Windisch, Hans (Germanistik-Student) siehe auch Windisch-Sartowsky
Windisch, Karl, Prof. Dr. (Biochemiker)
Windisch, Wilhelm, Prof. Dr. (Biochemiker)
Windisch-Sartowsky, Hans (Komponist)
Häufige Abkürzungen für die Herkunft der Dokumente
Kapitel 1
Die Zeitschrift Melos als Ausgangspunkt
Beschäftigt man sich eingehender mit der Geschichte der neuen Musik im Deutschland des zwanzigsten Jahrhunderts, wird man alsbald auf eine Zeitschrift mit Namen Melos stoßen.
Dieser fast schon unvermeidliche Vorgang sagt nicht allein etwas über die Verbreitung, sondern auch die Bedeutung der Zeitschrift: zunächst nach dem Ersten Weltkrieg in den zwanziger Jahren und später, nach dem
Zweiten Weltkrieg, vorwiegend in den fünfziger bis siebziger Jahren. Herausgeber-, Verlags- und Orts-Wechsel, Änderungen im Turnus des Erscheinens wie im Seitenumfang der Jahrgänge, eine zweijährige
Pause während des Höhepunkts der Inflation und ein schwerwiegender inhaltlicher Eingriff in der Zeit des Nationalsozialismus bilden dabei etwas ab von dem geschichtlichen Geschehen, in die
das Periodikum eingebunden war.
Neben einer professionellen Gestaltung, Anfertigung und Auslieferung gründete der gute Ruf der Zeitschrift auf zahlreichen Originalbeiträgen über die Musik der Gegenwart,
die begleitet waren von Werkbeschreibungen, Partiturausschnitten, ästhetischen Betrachtungen, Analysen, Porträts, Stellungnahmen, Notenbeilagen, Fotos, Erinnerungen sowie Besprechungen von Musikalien, Büchern,
Schallplatten und Konzerten. Inserate verwiesen auf anstehende Aufführungen und Festivals, Neuerscheinungen verschiedener Branchen und anderes mehr. Dies alles betraf vor allem den aktuellen Stand des
Komponierens und war oftmals von kundigen und angesehenen Fachleuten, wenn nicht den Künstlern selbst verfasst. Mochte man im Einzelfall auch anderer Meinung sein als die Autoren, das ein oder andere
vermissen oder die Gewichte anders verteilen, so erhielt man aufs Ganze gesehen doch einen kompetenten und liberalen Überblick über das zeitgenössische Geschehen in der Musik. Man konnte erkennen, wer worüber
nachgedacht hatte, zu welchen Ergebnissen man gelangt war und wer den Ton angab, sobald man sich von der Illusion einer objektiven Darstellbarkeit befreit hatte und die fast bei einer jeden Zeitschrift, ja
Veröffentlichung zu beobachtende Verflechtung von Kunst, Politik und Wirtschaft aufzulösen verstand.
Weiß man vielleicht noch, dass die Zeitschrift Melos einst von dem Dirigenten Hermann Scherchen (1891–1966) ins Leben gerufen und, seit ihrem ersten Heft im Februar 1920, zunächst in Berlin veröffentlicht worden war, so werden die Kenntnisse merklich geringer in jenen Jahren, die einerseits zwischen Scherchens Übergabe des Periodikums an Fritz Fridolin Windisch im Mai 1921 und andererseits nach zweijähriger Pause sowie erneuertem Wechsel in der Herausgeberschaft an Hans Mersmann im August 1924 liegen. [1] Zwar war der Lebensweg Mersmanns, der sich in seinen Tätigkeiten, Schriften und Ämtern fast ausschließlich im Bereich der Musik bewegte, vergleichsweise übersichtlich, doch mehrten sich die Irrtümer, Ungenauigkeiten, Versehen oder Missverständnisse in Bezug auf Windisch, so dass selbst sein Geburtsjahr uneinheitlich in die Literatur einging oder ihm Werke zugeschrieben wurden, die gar nicht von ihm stammten. Auch Windischs heutige Bezeichnung als „Musikwissenschaftler“ trifft die Thematik seines Schaffens nur zu einem geringen Teil, denn Begabung, Neigung und Ehrgeiz reichten bei ihm für weitaus mehr. Dabei stützten sich die Kenntnisse über Windisch hauptsächlich auf die Musiklexika in den zwanziger Jahren, deren Angaben, seien sie noch so unvollständig oder sogar falsch, in der Folge nur wiederholt wurden und mitunter bis heute verbreitet sind. [2] Jüngere Nachschlagewerke zur Musik verzichteten, da es offenbar nichts Neues mehr zu verzeichnen gab, schließlich ganz auf einen eigenen Artikel über
Windisch oder erwähnten ihn allenfalls beiläufig, sobald die Rede auf die Herausgeberschaft von Melos kam. [3]
Die musikalischen Werke Windischs wurden, der scheinbar nur allzu geringen Bedeutung ihres Autors gemäß, höchstens gestreift, bestenfalls in Form einer knappen Liste erfasst und mit dem
einen Satz beschrieben: „Seine Kompositionen sind charakterisiert durch ,rein melodisch bedingte Stimmführung‘.“ [4] Danach verschwand Windisch wieder so schnell aus der Musik, wie er in dieser bekannt geworden war, denn Mitte der zwanziger Jahre hatte er bereits eine entscheidende berufliche Wende vollzogen, hatte sich von der Kunst gelöst und war, dem Vorbild seines Vaters folgend, zur Naturwissenschaft und Forschung übergewechselt. Die Grundlagen dieser Forschung waren sicher nicht mehr der großen Öffentlichkeit zugedacht, sondern traten für ein anderes Publikum in Zeitschriften und später in Nachschlagewerken anderer Art zutage, setzten umfangreiche Kenntnisse voraus und waren daher fast nur Wissenschaftlern, welche sich um die Lösung derselben oder ähnlicher Probleme bemühten, bis in Einzelheiten hinein begreiflich. Soweit es sich erkennen lässt, verfasste Windisch nach 1924 keine musikalischen oder literarischen Werke mehr, und jegliches Interesse an Kunst schlechthin scheint nach diesem Zeitpunkt zu erlöschen. Einige Gründe, wie und warum es zu diesem erstaunlichen Wechsel zur Wissenschaft kam, werden im Verlauf dieser Abhandlung angesprochen.
Nach einem Studium in Leipzig und Berlin mit anschließender Promotion und Habilitation sowie dem Aufbau eines eigenen wissenschaftlichen Instituts wurde Windisch nach dem Zweiten
Weltkrieg immer mehr zu einem der herausragenden Biochemiker der Deutschen Demokratischen Republik, von dem bei seinem Tod im Jahre 1961 schließlich an die zweihundert wissenschaftliche Veröffentlichungen
vorlagen. Diese Betätigung ging von der Chemie der Gärungen aus, wie sie etwa durch die Versuche von Louis Pasteur [5] oder im Brauereiwesen bekannt waren, führte im Laufe der Zeit aber auch zu zellphysiologischen Untersuchungen, die sich ihrerseits in vielfältigen Beiträgen zur Krebsforschung niederschlugen. Erfindungen und Patente auf dem Gebiet der technologischen und physiologischen Arbeits- und Messmethoden sowie die gemeinsam mit dem Biochemiker Hugo Haehn [6] gewonnenen Erkenntnisse im Bereich von Vitaminbier und Vitaminpräparaten verliehen Windisch in Fachkreisen internationale Anerkennung. Im Jahre 1950 wurde er Direktor des „Instituts für zellphysiologische Krebsforschung“ der „Deutschen Akademie der Wissenschaften“, und die akademische Laufbahn des Biochemikers gipfelte 1955 in einem Lehrstuhl an der Berliner „Humboldt-Universität“ sowie in der Verleihung des „Vaterländischen Verdienstordens“ in Silber [7]. Verwiesen sei auf das 1962 von der „Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig“ im Berliner Akademie-Verlag herausgegebene Biographisch-literarische Handwörterbuch von J. C. Poggendorff, in dem ein Abriss von Windischs naturwissenschaftlicher Laufbahn steht und auf mehreren Seiten seine diesbezüglichen Veröffentlichungen verzeichnet sind. Ebenso ist hier aber ein Beitrag über Windischs Vater Prof. Dr. Wilhelm Windisch (1860–1944) zu finden, der als Gärungs-Chemiker bereits um die Wende zum zwanzigsten Jahrhundert verschiedene Bücher und Aufsätze über die Gärungswissenschaften und Braukunst veröffentlicht hatte und der einer der anerkannt fortschrittlichsten wie beliebtesten Persönlichkeiten in seinem Fache war. [8] Dieses Beispiel mag die endgültige Berufswahl seines Sohns bestimmt oder beeinflusst haben. [9] Dass in den Jahren 1895/96 ein Mälzer und Brauer mit Namen „J. Windisch“ in Berlin lebte, könnte ein Hinweis auf eine noch längere Familientradition sein, wobei zu berücksichtigen ist, dass der Nachname Windisch nicht allzu selten ist. [10]

Abb. 1
Fritz Windisch
1895–1961
spätestens 1960; der Fotograf ist unbekannt [11]
Kapitel 2
Drei Lebensläufe (I–III)
Da ein Autor musikbezogener Schriften namens Fritz oder Fritz Fridolin Windisch
in den konsultierten Bücher- und Handschriften-Katalogen ab Mitte der zwanziger Jahre regelmäßig nicht mehr genannt wurde und statt dessen die Dissertation eines Fritz
Windisch über die Essiggärung und später eine Habilitationschrift über die Bedeutung des Sauerstoffs für die Hefe in Erscheinung traten, war unter anderem zu vermuten,
dass es sich hier um ein und dieselbe Person handeln könnte. Dieser Wandel war zwar ungewöhnlich, lag aber umso näher, als unter der Adresse von Fritz Windisch (in Berlin-Niederschönhausen, Lindenstraße 35 b [12]) auch ein Wilhelm Windisch wohnte, der „Prof. Dr.“ war und bei dem es sich um den Vater Windischs hätte handeln können.
Und da sich von diesem Wilhelm Windisch auch mehrere Publikationen nachweisen ließen, die auf brau- und gärungstechnische Dinge Bezug nahmen, war dieser
Zusammenhang jedenfalls zu berücksichtigen. Darüber hinaus wurde in Erich Hermann Müllers Deutschem Musiker-Lexikon (1929) unter dem Artikel über den
Komponisten und Musikschriftsteller Fritz Windisch die Adresse „Lindenstraße 35 b“ in Berlin-Niederschönhausen ebenso angegeben, was die Vermutung bekräftigte. [13]
Um Klarheit zu erlangen, wandte ich mich an das Archiv der „Humboldt-Universität“ in Berlin und fragte brieflich an, ob etwas über das Studium eines Fritz (Fridolin)
Windisch um 1920 herum bekannt sei und sich vielleicht ein Curriculum Vitae (Lebenslauf) in den Akten oder den veröffentlichten Universitätsschriften befinde.
Darauf wurden mir unter anderem drei mit Schreibmaschine ausgefertigte und handschriftlich signierte Lebensläufe Windischs als Fotokopie überlassen:
I – ein undatierter Lebenslauf von nur 6 Zeilen, der die Einreichung von
Windischs Dissertation am 11. November 1925 begleitete und später in gedruckter Form in der Dissertation selbst erschien (Signatur: Phil. Fak. 651, Blatt 116) [14];
II – ein undatierter Lebenslauf von 2 Seiten [zwischen 1945 und 1947 in Schlitz, Hessen, entstanden] (Signatur: PA [Personalakten] – Windisch, F., Bd. 1, Bl.
17 u. 18), und schließlich
III – ein Lebenslauf vom 26. Juli 1948, geschrieben in Berlin (Signatur: PA – Windisch, F., Bd. 3, S. 8), von nur 1 Seite.
Diese drei Lebensläufe sind hier mit I, II und III nummeriert, um sie besonders von dem auf der dritten Webseite in Kapitel 7 zitierten Lebenslauf IV zu unterscheiden; die Lebensläufe sind dort dann auch chronologisch geordnet (vgl. hier).
Da der undatierte Lebenslauf II Windischs Vortragstätigkeit bis zum Jahre „1944“ erwähnt und später auch vom Jahr „1947“ spricht, wurde er sicherlich erst nach dem
Zweiten Weltkrieg verfasst, lag möglicherweise einer Bewerbung bei und entstand vielleicht in zeitlicher Nähe zu dem Lebenslauf III. Zu Beginn von Lebenslauf II heißt es:
„Dr. Fritz Windisch, | z[ur] Z[ei]t Gräflich Görtzische Brauerei. | Schlitz (Hessen) | Lebenslauf | Eingereicht an die Landwirtschaftliche Fakultät der Universität Berlin“. [15]
Diese drei Lebensläufe sind Dokumente aus erster Hand, die übereinstimmend – auch
übereinstimmend mit Lebenslauf IV – als Geburtstag deutlich den 20. Dezember 1895 (und nicht 1897 oder 1898) in Berlin-Niederschönhausen nennen. [16] Die Unterschrift von Hand ist in allen drei Fällen ähnlich und hat unverkennbar dieselben Züge wie die Unterschriften in den an Arnold Schönberg oder Josef Matthias Hauer gerichteten
Briefen aus den Jahren 1921 bis 1923, die zum Teil auch auf Briefpapier von „Melos“ stehen. In diesen Schreiben ist die Adresse des Absenders vorgedruckt, auf den Brief
gestempelt oder handschriftlich ausgeführt, und jeweils ist „Niederschönhausen“ und die „Lindenstraße 35b“ klar zu lesen. Dass es sich hier um dieselbe Person handelte, die
zunächst musikalischen Interessen nachging und später Biochemiker wurde, war den erhaltenen Dokumenten damit mehrfach und unzweideutig zu entnehmen.
Der Text des Lebenslaufs III von 1948, der bereits wichtige Stationen nannte, sei zunächst wiedergegeben. Aus dem undatierten Lebenslauf II wird darauf
im Anschluss ein Abschnitt zitiert, weil hier der Entzug von Windischs Lehrbefugnis im Nationalsozialismus eingehender zur Sprache kommt.
„Prof. Dr. Fritz Windisch
B[er]l[i]n-Niederschönhausen,
Grabbeallee 48 [17]
26. Juli 1948
L e b e n s l a u f
eingereicht an die Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät
der Universität Berlin
Als Sohn des Dr. Wilhelm Windisch, Professor am Institut für Gärungsgewerbe
in Berlin, bin ich am 20. Dezember 1895 in Berlin-Niederschönhausen geboren. Ich absolvierte das Realgymnasium zu Berlin-Pankow. Nach Teilnahme am
ersten Weltkrieg 1914/1918 studierte ich zuerst Kunstgeschichte und Musik und ging dann zum Studium der Naturwissenschaften über. An den Universitäten
Berlin und Leipzig studierte ich Chemie, Physikalische Chemie, Botanik, Geologie und Philosophie und promovierte 1925 an der Universität Berlin zum
Doktor der Philosophie mit einer Arbeit über ,Das Wesen der Essiggärung und die chemischen Leistungen der Essigbakterien‘, die ich unter Prof. Dr. Carl Neuberg [18] am Kaiser-Wilhelm-Institut für Biochemie in Berlin Dahlem ausgeführt hatte.
1926 wurde ich wissenschaftlicher Assistent am Institut für Gärungsgewerbe in
Berlin und führte an den biologischen, biochemischen und gärungstechnologischen Abteilungen dieses Instituts wissenschaftliche und technologische Arbeiten durch, die in den verschiedenen Fachzeitschriften
veröffentlicht worden sind. 1928 wurden mir biotechnische Vorlesungen am Institut für Gärungsgewerbe übertragen. Mit einer Arbeit über ,Die
Bedeutung des Sauerstoffs für die Hefe und ihre biochemischen Wirkungen‘ habilitierte ich mich 1930 an der Universität Berlin für das Fach der ,Biochemie‘.
1932 gründete ich ein eigenes ,Institut für Gärungsforschung‘ in Berlin. [19]
Aufgrund von § 6 des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums wurde ich wegen meiner engen Verbindung mit Prof. Neuberg [20] von
der Universität Berlin relegiert. [21] Ich war aber in der Lage, mein eigenes
Untersuchungs- und Forschungslaboratorium in Berlin weiterhin zu unterhalten, so dass ich laufend wissenschaftliche und gärungstechnologische Arbeiten veröffentlichen und in der Zeit von 1935 bis 1944 mehr als 50 Fachvorträge über aktuelle Gärungsprobleme halten konnte. Am 17. April 1947 wurde
ich als Professor mit Lehrauftrag für ,Biochemie‘ in der Landwirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät der Universität Berlin berufen und halte daselbst
Vorlesungen über Angewandte Biochemie und Biotechnik.
[handschriftlich:] F. Windisch
[wieder maschinenschriftlich:] (Prof. Dr. F. Windisch)“ [22]
Das von Christoph Jahr und Rebecca Schaarschmidt herausgegebene Buch Die Berliner Universität in der NS-Zeit (2005) hält fest, dass Windisch unter dem
Nationalsozialismus heftigen Angriffen der Studentenschaft ausgesetzt war, und man machte ihm unter anderem den Vorwurf, bereits als Schüler kommunistischen Ideen
angehangen zu haben. Steffen Rückl und Karl-Heinz Noack schreiben in ihrem Aufsatz Studentischer Alltag an der Berliner Universität 1933 bis 1945 des genannten Buchs:
„Dr. habil. Fritz Windisch, Privatdozent für Biochemie seit 1931 am Institut für Gärungsgewerbe und Stärkefabrikation, war zur Zielscheibe der
nationalsozialistischen Studentenschaft geworden. In einer Eingabe der Studentenschaft der Landwirtschaftlichen Hochschule an den Führer der Deutschen Studentenschaft Gerhard Krüger [23] von Anfang Mai 1933 wurde Windisch in übler Weise diffamiert und beleidigt. Ihm wurden kriminelle Handlungen unterstellt und er wurde als Anhänger des Kommunismus
bezeichnet, der schon als Schüler kommunistische Ideen vertreten habe. Deshalb wurde seine sofortige Abberufung verlangt. Nachdem er am 10. Mai 1933
zunächst mit sofortiger Wirkung beurlaubt wurde, erfolgte kurz darauf der Entzug der Lehrbefugnis. Nach 1945 kehrte Fritz Windisch, jetzt als Professor mit Lehrstuhl, an die Universität zurück.“ [24]
Bei den Vorgängen im Nationalsozialismus sei noch verweilt, da Windischs Lebenslauf II auf zusätzliche Einzelheiten eingeht, zumal der ansonsten wertvolle
Aufsatz von Willy Nordheim zu Windischs 65. Geburtstag auf die Zeit des Nationalsozialismus nicht zu sprechen kommt. [25] So heißt es in den letzten Absätzen
des in Schlitz verfassten Lebenslaufs II auf Blatt II:
„1932 trat ich auf eigene Veranlassung aus dem Institut für Gärungsgewerbe
in Berlin aus und gründete ein eigenes ,Institut für Gärungsforschung‘ in Berlin. Mitten in dieser Aufbauarbeit wurde ich 1933 auf Betreiben des Dozentenführers Prof. Dr. [Erhard] Landt [26] und einiger anderer nationalsozialistischer Dozenten wegen meiner antifaschistischen Einstellung von
der Gestapo verhaftet und anschliessend aus dem Lehrkörper der Universität ausgestossen. Das Entlassungsschreiben, das sich im Original in meinem Besitz befindet, lautet:
,Auf Grund von § 6 des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7. April 1933 entziehe ich Ihnen hiermit die Lehrbefugnis an der Universität Berlin. [27] Der Reichs- und Preussische Minister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung.‘
Nach meiner Entlassung von der Universität habe ich ein eigenes Untersuchungs-
und Forschungslaboratorium in Berlin unterhalten, dabei eine Tätigkeit als technischer Berater der Gärungsindustrien ausgeübt, laufend wissenschaftliche
und gärungstechnologische Arbeiten veröffentlicht und mehrere technische Neuerungen (D.R.P. [Deutsches Reichspatent]) in die Gärungsindustrien eingeführt. In der Zeit von 1935 bis 1944 habe ich mehr als
50 Vorträge mit anschliessender Diskussion über aktuelle Gärungs-, Mälzungs- und Brauprobleme (die Themen waren jeweils spezifiziert) in den einzelnen
Sektionen der ,Technisch-wissenschaftlichen Vereinigung des Brauerei- und Mälzereigewerbes (e.V.)‘ gehalten; ausführliche Referate über meine
Vortragstätigkeit finden sich in den verschiedenen Organen der Fachpresse.“
Bestätigt wurde die „Entziehung der Lehrbefugnis“ zusätzlich durch eine in der Administration des Nationalsozialismus entstandene Karteikarte, die aus dem
ehemaligen „Berlin Document Center“ stammt und sich heute im Bundesarchiv in Berlin befindet. Hieraus geht hervor, dass Windischs Lehrbefugnis am 1. Juni 1935 entzogen
wurde. Windischs sofortige Beurlaubung im Jahre 1933 wird in der folgenden Fußnote angesprochen. [28] Schließlich erhielt ich im Frühjahr 2012 die folgende amtliche
Bescheinigung, die den Fall wohl endgültig klärt:
Abb. 2
Beglaubigte Abschrift der Verfügung vom 1. Juni 1935,
die Fritz Windisch die Lehrbefugnis an der Universität Berlin entzog. [28a]
Dass Windisch nach seiner Entlassung durch die Nationalsozialisten zwar nicht an der
Universität unterrichten, aber doch wissenschaftlich weiterarbeiten konnte, dürfte nicht zuletzt auf die Protektion des Dirigenten und Komponisten Wilhelm Furtwängler (1886
bis 1954) zurückgehen, denn Furtwänglers Fürsprache ist in seinem Brief vom 5. März 1934 überliefert und wurde von Windisch nach dem Krieg ausführlicher erklärt. Furtwänglers Brief, der sich vermutlich an die Verantwortlichen im Nationalsozialismus
richtete, lautete:
„Soweit ich die literarische Tätigkeit des Herrn Dr. Fritz W i n d i s c h kenne
– er war u[nter] a[nderem] Redakteur des ,Melos‘ zu der Zeit, wo dieses Blatt noch nicht jenen linksradikalen Charakter hatte, den es später bekam –
war derselbe bei allem Reichtum an Problemstellung doch stets durchaus aufbauend deutsch in gutem Sinne. Er gehörte daher keinesfalls zu jenen, die es
nötig haben, dem heutigen Deutschland gegenüber einen Frontwechsel zu markieren.
Wilhelm Furtwängler“ [28b]
Dieser Einsatz Furtwänglers für Windisch kam, wie gesagt, erst Jahre später zur
Sprache, als Windisch ihn gegenüber Johannes R. Becher (1891–1958), dem ersten Präsidenten des „Kulturbundes zur demokratischen Erneuerung Deutschland“
(gegründet am 4. Juli 1945), in den erforderlichen Zusammenhang stellte und hierbei das Furtwängler zukommende Verdienst deutlich unterstrich:
„A b s c h r i f t
Schreiben vom 23. Februar 1946, gleichzeitig gerichtet an Joh. R. B e c h e r
als Präsident des Kulturbundes und Prof. Dr. Joh. S t r o u x als Rektor d[er] Universität
Durch die Presse erfuhr ich, dass der ,Offene Brief an Furtwängler‘, der sich für die Rückkehr Wilhelm Furtwänglers nach Berlin als Dirigent des
Philharmonischen Orchesters einsetzt, auch Ihre Unterschrift trägt. [28c] Es ist
mir ein spontanes Bedürfnis, Ihnen zu versichern, dass Sie gut und richtig gehandelt haben, wenn auch die amerikanische Militärregierung vorläufig anderer
Meinung ist und manche Vorkommnisse scheinbar gegen Furtwängler sprechen. Als Beweis möchte ich das nachfolgende persönliche Erlebnis mit Furtwängler anführen:
Als ich mich infolge politischer Denuntiation [Denunziation] in den Händen der Gestapo befand und mein Leben wegen schwerwiegendster politischer
Anschuldigungen verwirkt zu sein schien, liess ich in meiner Verzweiflung einen letzten Notruf an Wilhelm Furtwängler richten. Dieser kannte mich
als Veranstalter der Berliner ,Melos-Konzerte‘, denen er öfter beigewohnt hatte, und als Herausgeber der Musikzeitschrift ,Melos‘. Ohne zu zögern, griff
Furtwängler sofort ein, warf das ganze Gewicht seiner Persönlichkeit für mich in die Waagschale und erreichte, dass die Schergen auf Befehl von höherer Stelle
von mir abliessen. Durch dieses mutige und rückhaltlose Eintreten bewahrte mich Furtwängler vor einem entsetzlichen Ende in den Klauen der Gestapo. Zu einer
solchen menschlichen Tat wäre Furtwängler nicht fähig gewesen, wenn er Nazi gewesen wäre.
Jetzt, da Furtwängler in Bedrängnis ist, möchte ich gern auch für ihn eintreten;
es besteht aber für mich keine Verbindungsmöglichkeit mit Wien. [28d] Darum
bitte ich Sie ergebenst, den Kampf um Furtwängler nicht aufzugeben und dabei von meiner Mitteilung weitestgehenden Gebrauch machen zu wollen.
Mit ausgezeichneter Hochachtung
gez. F. W I N D I S C H
Dozent Dr. Fritz Windisch,
S c h l i t z (Hessen),
Stadtberg 5“ [28e]
Becher bestätigte den Erhalt des Briefs von Fritz Windisch einen Monat später und antwortete:
„Kulturbund zur demokratischen Erneuerung | Deutschlands |
BERLIN W15 · SCHLÜTERSTRASSE 45 | FERNRUF 32 26 06 · 32 26 07
DER PRÄSIDENT
Berlin, 23. März 1946
Herrn
Dr. Fritz Windisch,
Schlitz (Hessen)
Stadtberg 5
Sehr geehrter Herr Dr. Windisch!
Ich danke Ihnen für Ihre Erklärung im Fall Furtwängler[,] die wir den
entsprechenden Stellen vorlegen werden. Ich persönlich werde alles tun, diesen Fall bis zu einer gerechten Entscheidung weiterzuführen.
Mit besten Grüßen
Ihr
Joh. R. Becher.
POSTSCHECKKONTO: BERLIN 40 351
BANKKONTEN: BERLINER STADTKONTOR 95 236 · BEZIRKSBANK CHARLOTTENBURG 95 456“ [28f]
Eine Todesanzeige, die am 11. April 1961 in der Berliner Zeitung erschien, bestätigt
und ergänzt noch Teile des Lebenslaufs III von 1948. Sie lautet:
„Nach langem schwerem Leiden wurde uns der Direktor | des Bereiches Zellphysiologie am Institut für Medizin | und Biologie der Deutschen Akademie der
Wissenschaf- | ten zu Berlin | Herr Prof. Dr. habil. | Friedrich Windisch | Träger des Vaterländischen Verdienstordens in Silber | Professor mit Lehrstuhl für Biochemie | an
der Humboldt-Universität zu Berlin | am 7. April 1961 durch den Tod entrissen. | Sein Leben und Schaffen stand im Dienste der Krebs- | forschung. Wir verlieren in
ihm eine Persönlichkeit von | lauterem Charakter, selbstloser Güte und aufopfernder | Pflichterfüllung. Sein Andenken wird in seinem Werk | weiterleben | Institut für
Medizin und Biologie der | Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin | Institutsleitung SED-Betriebsparteiorganisation | Betriebsgewerkschaftsleitung |
Beisetzung am Mittwoch, dem 12. 4. 1961; um 13 Uhr, Städtischer | Friedhof Pankow, Abteilung III, Bahnhofstraße“ [29]
Drei Wochen vor seinem Tode wandte sich Fritz Windisch in einem Brief an Dr. med. Joseph Evers (1894–1975) in Hachen – heute ein Teil von Sundern
im Hochsauerlandkreis – und bat um Aufnahme in seinem Sanatorium, denn die dort eingeführte Diät erscheine den Ärzten noch das einzige Hilfsmittel in seiner Lage zu sein. Zur medizinischen Vorgeschichte führte Windisch aus, dass sich seine Erkrankung nach einer asiatischen Virusgrippe im Herbst 1957 eingestellt habe. Sie wurde von
Fachärzten als „Bulbäre Paralyse“ diagnostiziert, eine neurologische Erkrankung unbekannter Ursache, die mit Muskelschwund und Lähmungs-Erscheinungen
einhergeht und die Windisch im weiteren Verlauf so stark behinderte, dass er seine berufliche Tätigkeit „nur noch unter Aufbietung aller Energie ausüben“ konnte.
Ergänzend teilte mir Windischs Sohn mit, dass sein Vater letztlich „an einem fieberhaften Infekt, der sich zu einer Lungenentzündung ausweitete“, verstarb. [29a]
Kapitel 3
Erster Weltkrieg, Reifeprüfung, Studium in Leipzig und Berlin
Erster Weltkrieg und Reifeprüfung
Zwar ist allen drei genannten Lebensläufen (Kapitel 2) zu entnehmen, dass Windisch
am Ersten Weltkrieg 1914–1918 teilgenommen hatte, doch gehen aus anderen Quellen weitere Einzelheiten hervor. In seinem undatierten Lebenslauf II aus Schlitz schreibt Windisch:
„Ich absolvierte das Realgymnasium zu Berlin-Pankow und war anschliessend
von 1914 bis 1918 Marinesoldat im ersten Weltkrieg. 1918 als
d. u. [dienstunbrauchbar] vom Militär entlassen, begann ich nach allmählicher Besserung meines Gesundheitszustandes zuerst Kunstgeschichte und Musik zu
studieren und ging danach zu dem Studium der Naturwissenschaften über.“ [30]
Da hier anfangs die Rede von dem Realgymnasium in Berlin-Pankow ist, sei zunächst erwähnt, dass Windischs „Zeugnis der Reife“ laut der späteren „Meldung zur
Promotionsprüfung“ an der Universität auf den „2. Dezember 1915“ datiert ist. Windisch selbst schreibt in seinem ersten, in seiner Dissertation wiederzufindenden Lebenslauf I (siehe oben), dass er „das Maturitätszeugnis 1916“ am Real- Gymnasium zu Pankow erhalten habe, doch könnte die Unstimmigkeit allein auf der
Zustellung der Urkunde nach dem Jahreswechsel beruht haben. Nimmt man den folgenden Karteikarten-Eintrag der Leipziger Quästur in die Berechnung auf,
so müssten sich beiden Angaben zufolge das Ende des Schulbesuchs und die Kriegsbeteiligung aber überschnitten haben.

Abb. 3
Fritz-Fridolin Windisch, 1914
Fotograf unbekannt (FWN)
Weiteres über Windischs militärischen Werdegang sowie sein erstes Semester an der Leipziger Universität ist ebenfalls in deren „Quästurkartei“ festgehalten. [31] Die Handschrift des Karteikarten-Eintrags ist zwar teilweise nicht leicht zu entziffern,
doch lassen sich folgende Angaben mit wohl hinreichender Verlässlichkeit wiedergeben: Windisch wurde als „Kriegsfreiwilliger“ 1914 in die „Matrosen-Artillerie-Abteilung“
von Friedrichsort – ein alter Militärstützpunkt, heute ein Stadtteil im Norden Kiels – aufgenommen. 1915 war er „im Felde“ bei dem „2. Matrosen-Artillerie-Regiment“;
1916 wurde er „Obermatrose“, dann „Maat“ und „Reserve-Offizier-Aspirant“. Nachdem er 1917 zum „Bootsmannsmaat“ befördert worden war, wurde Windisch am
31. März 1918 als „dienstunbrauchbar“ entlassen. [32] Ein anderer Grund für seine Entlassung wird nicht genannt, [33] doch schreibt Windisch in seinem zuletzt zitierten Lebenslauf, dass er sein Studium der Kunstgeschichte und Musik erst „nach
allmählicher Besserung“ seines „Gesundheitszustandes“ begann, so dass von einer Erkrankung oder Verwundung auszugehen ist. [34]

Abb. 4
Fritz-Fridolin Windisch, 1917
Zeichnung von Werner Siebert, rechts unten signiert
mit dem Vermerk: „Res[erve-] Lazarett ,Nord‘ | 1917“ (FWN)
Zwar gibt es keinerlei Belege für einen Zusammenhang der Ereignisse mit Fritz Windisch, doch sei wenigstens am Rande vermerkt, dass es Ende Oktober 1918
in Kiel zum sogenannten Matrosenaufstand kam. Dieser Aufstand wird vielfach als Vorbote, ja Beginn der deutschen Novemberrevolution von 1918 betrachtet,
aufgrund derer das Ende der Jahrhunderte alten Monarchie in Deutschland erfolgte. Befehlsverweigerungen und Meutereien auf Schiffen der Kaiserlichen Marine gingen
voraus, der Ruf nach „Frieden und Brot“ wurde laut, die Rote Flagge vielfach auf Häusern wie Schiffen gehisst, Soldatenräte gegründet. Tausende versammelten sich
Anfang November 1918 zu Kundgebungen in Kiel. Es kam zu Schüssen in die Menge der Demonstranten; sieben Menschen starben, ein Mehrfaches wurde schwer verletzt,
so dass sich die Auseinandersetzungen zu Gewalttätigkeiten steigerten.[35]
Studium in Leipzig
Neben der militärischen Laufbahn geht aus der Karteikarte der Quästur in Leipzig hervor, dass sich Windisch am 27. Mai 1918 an der „Universität Leipzig“ unter der
Nummer „594“ einschrieb, doch bereits am 31. August 1918 mit einem auf diesen Tag datierten Abgangszeugnis sein Leipziger Studium wieder beendete. Weiteren
Aufschluss über den Aufenthalt an der Universität, der in zeitlicher Folge zunächst in Leipzig, dann in Berlin stattfand, lieferte das sogenannte Sittenzeugnis (Leumunds-
oder Führungszeugnis hinsichtlich von Vorstrafen), das sich wie vorstehende Karteikarte heute im Universitätsarchiv Leipzig befindet (Signatur: UAL,
Sittenzeugnisse). Aus diesem Dokument sind die Fächer, die Windisch belegt hatte, zu ersehen. Der Begriff „Musikwissenschaft“ fiel dabei ebenso wenig wie der Name von Hugo Riemann, und die von Johannes Volkelt angebotenen Vorlesungen über „Kunst
und künstlerisches Schaffen“ sowie Vorlesungen über Schopenhauer von Max Brahn waren die einzigen Gebiete, die nicht der Naturwissenschaft angehörten.
„Anorganische Experimentalchemie Hantzsch. [36]
Ergänzung dazu
Analytische Chemie Schäfer. [37]
Analytisch- und anorganisch-chemisches Halbpraktikum Hantzsch. [38]
Allgemeine Botanik Pfeffer. [39]
Experimentalphysik Wiener. [40]
Kunst und künstlerisches Schaffen Volkelt. [41]
Schopenhauer Brahn.“ [42]
Studium in Berlin
Windisch immatrikulierte sich in Berlin am 18. September 1918, wobei er an der Philosophischen Fakultät der „Friedrich-Wilhelms-Universität“ zu Berlin unter
der Matrikel-Nummer 3170 des Rektorats geführt wurde. [43] Ein „Entwurf“ des Abgangszeugnisses der Universität, welcher das Immatrikulationsdatum
wiederholte, ist auf den 19. Dezember 1923 datiert, doch wurde die Zeit des Studiums nur ab der Immatrikulation „bis zu seiner [Windischs] am 18.4.[19]21 wegen Nichtann[ahme] von Vorles[ungen] erfolgten Löschung als Studierender der Philosophie“ gerechnet. [44] Auch wenn es sich hier um ein vergleichsweise kurzes Studium gehandelt zu haben scheint, nennt die „Meldung zur Promotionsprüfung“, die
vom Dekan der philosophischen Fakultät [Ludwig] Diels unterschrieben wurde (siehe nächsten Abschnitt), unter dem Vordruck „Nachweisung des akademischen
Trienniums“ als handschriftlichen Eintrag: „Leipzig 1 Semester Berlin 5 Semester“.
Promotion und Habilitation
Über Windischs Promotion waren noch andere Dokumente im Archiv der „Humboldt-Universität“ vorhanden, nämlich zunächst die „Meldung zur Promotionsprüfung“ vom
13. und 27. November 1925, welche vom Dekan der Philosophischen Fakultät Diels unterzeichnet wurde und welche die Herren [Carl] Neuberg und [Hermann] Thoms
um Beurteilung von Windischs Dissertation sowie um den Vorschlag eines geeigneten Prädikats für diese ersuchte. Die hierauf anberaumte Sitzung am 24. Juni 1926, bei der
Windisch in seinen angemeldeten Fächern von den verschiedenen Lehrkräften geprüft wurde, kam zu dem Ergebnis, dass die Dissertation mit „valde laudabile“, die mündliche
Prüfung mit der Gesamtnote „cum laude“ zu bewerten sei. Windischs Prüfung wurde nur in naturwissenschaftlichen Fächern abgelegt, und eine Ausnahme bildete einzig
„Philosophie“, wobei Heinrich Maier die Leistungen des Kandidaten über Immanuel Kants Kritik der reinen Vernunft mit dem Prädikat „Recht gut“ bedachte. Windischs Prüfer waren im Einzelnen:
Carl Neuberg unterzeichnete handschriftlich am 10. November 1925 die ansonsten mit der Schreibmaschine ausgefertigte „Bescheinigung“, dass Fritz Windisch seine
Dissertationsarbeit Das Wesen der Essiggärung und die chemischen Leistungen der Essigbakterien „im Laufe des Wintersemester[s] 1924/25 und des Sommersemesters
1925“ unter seiner Leitung ausgeführt habe. Diese Bescheinigung war auf vorgedrucktem Briefpapier des „Kaiser Wilhelm-Instituts für Biochemie“ in Berlin-Dahlem ausgestellt. [45]
Die Habilitation von Fritz Windisch erfolgte ab dem Jahr 1930 und hatte zur Grundlage die Schrift: Die Bedeutung des Sauerstoffs für die Hefe und ihre
biochemischen Wirkungen. [46] Offiziell ausgesprochen wurde die Habilitation von der Landwirtschaftlichen Hochschule wohl erst im Jahr 1932. [47]
Kapitel 4
Familiäre Verhältnisse
Versucht man die familiären Verhältnisse von Fritz Windisch zu klären, wird man bald
feststellen, dass er allenfalls seinen Vater in den Lebensläufen erwähnte (siehe Kap. 2). [48] Weder seine Mutter, Geschwister, Ehefrau noch sonstige Angehörige der Familie
kommen in den ausgewerteten Quellen gewöhnlich zur Sprache, und so hat man vielleicht davon ausgehen, dass Windisch die strikte Trennung von Privat- und Berufsleben beabsichtigte. [48a] Eine allgemeine Zurückhaltung wird hier sichtbar, die auch in dem Aufsatz von Ludwig Kantorowicz in der Weltbühne anklingt. [49] Diese Auffassung wurde von Dr. Peter Lietz bestätigt, der mir berichtete, dass Windisch
„über seine persönlichen Verhältnisse offensichtlich nicht viel erzählt“ habe. Nur durch eine Auskunft der Friedhofsverwaltung in Pankow ließ sich daher zunächst feststellen,
dass Windisch auch verheiratet war. [50] Später erfuhr ich von Dr. Lietz, dass Dr.
Willy Nordheim, Windischs langjähriger Assistent, Windischs Grab vor der Auflösung auf dem Pankower Friedhof gemeinsam mit seiner Frau gepflegt habe. Ebenso geht auf
Dr. Lietz der Hinweis zurück, dass bereits Wilhelm Windisch komponiert hatte. [51]
Zwar erscheint ein „Hans Windisch“ im Studentenverzeichnis der Universität Berlin mit
derselben Adresse wie Fritz Windisch (Niederschönhausen, Lindenstraße 35 b), wobei Hans Windisch von 1916 bis 1917 in Berlin Germanistik studierte. [52] Dennoch war lange Zeit die Zusammengehörigkeit dieses Hans Windisch mit der Familie Windisch in Niederschönhausen auf Mutmaßungen angewiesen. Erst der Brief von Dr. Christian
Windisch, dem Sohn Fritz Windischs, erbrachte in dieser Hinsicht mehr Aufschluss, als der Genannte in seinem ersten Brief an mich schrieb:
„Einige Fakten kann ich umgehend klären: Mein Vater [Fritz Windisch] hatte
drei Geschwister – Ilse, Johannes, Wolfgang. Johannes (Hans) ist der besagte Kompositör Windisch-Sartowski (23.1.1894 – 1987). Seine gesamte
Hinterlassenschaft (Oper, Operette, Lieder) befindet sich in der Hand seines Sohnes […]. Wolfgang Windisch ist früh verstorben (etwa mit 18–20 Jahren).
Die Ursache seines Ablebens wurde stets verschwiegen.“ [52a]
Das von Arnold Ebel herausgegebene Berliner Musikjahrbuch 1926 nennt
in seinem von Dr. Walter Grube redigierten Adressenteil mit dieser Anschrift in Berlin-Niederschönhausen einen „Musikschriftsteller“ und „Komponisten“ namens
„Windisch-Sartowsky, Hans“. [53] Ein einzelner Eintrag zu Windisch-Sartowsky, Hans ist jedoch nur im Berliner Adreßbuch von 1927 zu finden, so dass ein Umzug
nach diesem Zeitpunkt und vor 1929 anzunehmen ist. [53a] Ein ausführlicherer Artikel
über den Komponisten „Windisch-Sartowsky, Hans“ wurde in E. H. Müllers Deutschem Musiker-Lexikon 1929 veröffentlicht, doch besteht der Eintrag außer dem
Geburtstag (23. Januar 1894 in Berlin) fast nur aus den Angaben der von ihm komponierten Werke (bis op. 51) und ihren Aufführungen. Müller ergänzt in eckigen
Klammern jedoch den Familiennamen des Komponisten als „Vindyš-Sartovský“, so dass man den Eindruck hat, es handele sich um einen tschechischen Komponisten,
zumal Brünn und Prag als Aufführungsorte in der anschließenden Werkliste genannt werden (siehe unten). Am Ende von Müllers Artikel lautet die Adressangabe des
Komponisten: „Schmachtenhagen b[ei] Oranienburg“. [54] Dass es sich hier nicht um
eine Verwechslung oder sogar einen fingierten Eintrag handelt, lässt sich durch die Operette Die weiße Herrin belegen. [55] Ein Eintrag in Frank-Altmanns Kurzgefaßtem Tonkünstler-Lexikon von 1936 wiederholt bloß einige Angaben von
Müller, nennt aber bei vielen Werken nur ihre Gattungen. [56] Unter Verwendung
verschiedener Varianten der Schreibweise „Windisch-Sartowsky“, ließen sich einige wenige Drucke nachweisen, die fast nur in die Zeit von 1929 bis 1936 fielen, darunter
auch Lieder in der künstlichen Weltsprache Esperanto.
Bei diesen Fragen der Herkunft der Familie ist auch zu beachten, was Wilhelm
Windisch über seine Vorfahren wie über seinen Bezug zur Musik sagte: „Eigentlich habe ich meinen Beruf verfehlt. Ich habe Talent zur Musik, denn meine Ahnen stammen aus Böhmen, wo die edle Musika zu Haus ist, dann aber auch für Land- und
Forstwirtschaft.“ [57] Das „Talent zur Musik“ wurde bei Wilhelm Windisch durch eine eigene Komposition sichtbar, nämlich das Alkoholische Lied, welches 1904 im 6.
Tausend bei Paul Parey in Berlin erschien und dessen Titelseite bei Lietz abgebildet ist: Dieser Druck ist der Burschenschaft „Cerevisia“ (lateinisch „Bier“; vgl. „cerveza“ im
Spanischen) als Kneiplied gewidmet. [58] Der Hinweis auf Böhmen könnte natürlich
mit der in Müllers Lexikon gebrauchten Umschrift in Zusammenhang stehen (siehe hier).
Im April 2012 ließen sich durch einen Brief des bereits erwähnten Dr. Christian
Windisch noch folgende Einzelheiten klären, die hier im Wortlaut zitiert seien:
„In erster Ehe war mein Vater mit einer Frau Ilse Windisch, geb[orene] Schütt verheiratet. Sie starb 1936 an einer mir nicht bekannten Erkrankung
(Tuberkulose?).
Im Mai 1939 heiratete mein Vater meine Mutter Maria Windisch, geb[orene] Ochschim, gesch[iedene] Stachelrodt. Sie brachte einen 1929 geborenen Sohn,
Günter Stachelrodt, mit in die Ehe. Mein Stiefbruder starb 72-jährig in Bayern. Meine Mutter, geb. am 23.8.1911, starb im 86. Lebensjahr in Berlin.” [58a]
Fortsetzung in Teil 2
Fortsetzung in Teil 3
Anmerkungen zu Teil 1
[1] Zur Geschichte von Melos vgl. die Einführung von Ole Hass, „Melos“ (Berlin,
1920–1934) auf einer Webseite des Retrospective Index to Music Periodicals 1800–1950 (2005) hier. Vollständige pdf-Fassungen der Einführung sind hier zu finden (englisch; S. ix–xvi) und hier (deutsch; S. xvii–xxiv). Die Verfasserschaft ist nur auf der zuerst genannten Webseite (html) mit der englischen Kurzfassung ausgewiesen, die
auch die Versionen des vollständigen Aufsatzes (pdf-Format) als download enthält. Vgl. weiterhin den Artikel Zeitschriften in Hugo Riemanns Musiklexikon (11. Aufl., Bd.
2, Berlin: Max Hesses Verlag, 1929, S. 2067, linke Sp.) sowie den in Fußnote [3] genannten Aufsatz (2001) von Stephan Schulze.
Zu den Vornamen von Windisch und dem Gebrauch des Bindestrichs zwischen ihnen vgl. Anm. [16], Absatz 2 sowie hier. Im vorliegenden Aufsatz wurde fast stets die
Form „Fritz Fridolin Windisch“ in früherer, „Fritz Windisch“ in späterer Zeit benutzt, da mir die Entstehung der Vornamen zunächst noch unbekannt war, ich andererseits
Einheitlichkeit anstrebte.
[2] Vgl. die Artikel über Windisch in den folgenden Nachschlagewerken: — Hugo Riemanns Musik-Lexikon, 10. Aufl., bearbeitet von Alfred Einstein, Berlin: Max
Hesses Verlag, 1922 (Vorwort auf S. X unterzeichnet: „München, 27. September 1922“), S. 1426. — Kurzgefaßtes Tonkünstlerlexikon von Paul Frank in der
Neubearbeitung durch Wilhelm Altmann, 12. Aufl., Leipzig: Carl Merseburger, 1926, Seite 452, rechte Sp. (unveränderter Nachdruck als 13. Aufl. 1927). — Kurzgefaßtes Tonkünstler-Lexikon, begründet von Paul Frank, neubearbeitet und ergänzt von
Wilhelm Altmann), 14. Aufl., Regensburg: Bosse, 1936, S. 691 (unveränderter Nachdruck als 15. Aufl., Wilhelmshaven: Heinrichshofen’s Verlag, 1971). — Das neue Musiklexikon, nach dem “Dictionary of Modern Music and Musicians”,
herausgegeben von A. Eaglefield-Hull, übersetzt und bearbeitet von Alfred Einstein, Berlin: Max Hesses Verlag, 1926, S. 706. — Hugo Riemanns Musiklexikon, 11.
Aufl., bearbeitet von Alfred Einstein, Berlin: Max Hesses Verlag, 1929, Bd. 2, S. 2034. — Erich H[ermann] Müller, Deutsches Musiker-Lexikon, Dresden: Wilhelm
Limpert, 1929, Sp. 1579. Aus einem Sonderzeichen unter dem Artikel und dem Abkürzungsverzeichnis des zuletzt genannten Lexikons (S. [IX], zuunterst) geht hervor,
dass Windisch seinen Fragebogen, mit welchem Müller die Angaben für sein Lexikon zusammentrug, nicht zurückgeschickt hatte. Müller entnahm in solchen Fällen seine
Kenntnisse vermutlich der ausgewerteten Literatur, die er auf S. [XI] angab. Gleichwohl ist hier die Berliner Adresse von Fritz Windisch genannt, die Müller zum
Versand seines Fragebogens bekannt gewesen sein muss.
Ergänzend lässt sich feststellen, dass in dem von Arnold Ebel herausgegebenen Berliner Musikjahrbuch 1926 (Berlin und Leipzig: Verlagsanstalt Deutscher
Tonkünstler A.-G.) die Angaben über die Adresse von Fritz Windisch auf Seite 236 nur seinem Bruder Hans Windisch-Sartowsky zugeschrieben werden; vgl. dazu auch Kapitel 4, Familiäre Verhältnisse, zweiter Absatz.
[3] Dies lässt sich wohl auch von Stephan Schulzes Aufsatz (2001) über Melos sagen,
der andererseits einen grundsätzlich guten Überblick über diese Zeitschrift vermittelt und manches Detail ins Bewusstsein hebt. Auf Windisch kommt sein Verfasser freilich
nur in negativer Weise zu sprechen, wenn er diesen als „unbedeutenden Berliner Musikwissenschaftler“ charakterisiert (S. 90) und auf derselben Seite schreibt: „So verflachten unter (dem von Scherchen wenig geschätzten) Windisch nicht nur die
Inhalte [von Melos], auch die in erster Linie wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wurden gegen 1922 untragbar […].“ Vgl. Stephan Schulze, Wo ist die Zeitschrift ,Melos‘ geblieben?, in: Musik & Ästhetik, hg. von Ludwig Holtmeier, Richard Klein
und Klaus-Steffen Mahnkopf, 5. Jg., Nr. 18, Stuttgart: Klett-Cotta, April 2001, S. 85–98. Meiner Ansicht nach wäre hier vielleicht eine Erklärung nicht überflüssig, wie
der Verfasser zu seiner abfälligen Einschätzung Windischs gelangte und worin genau er die „Verflachung“ der Zeitschrift Melos erblickt. Dass Scherchen Windisch wenig
schätzte, mag sachlich zwar richtig sein, auch wenn für diese Aussage kein Beleg angegeben ist. Ebenso ist aber das Umgekehrte vorstellbar, zumal hierfür durchaus Anzeichen vorhanden sind (vgl. hier). Mir scheint dies freilich kein hinreichender Grund
für eine negative Bemerkung zu sein, die den Bekannteren immer mit dem Bedeuteren gleichsetzt. Die Ursache einer Distanz zwischen Scherchen und Windisch könnte ja
allein darin bestanden haben, dass Windisch nicht nach Scherchens Pfeife tanzte (vgl. hier im Unterkapitel Der Name „Melos“).
Gleichermaßen widerspricht Schulzes Meinung dem Umstand, dass Scherchen
während seiner anfänglichen Herausgeberschaft Windisch auf den äußeren Titelseiten von Melos mehrfach „Ständigen Mitarbeiter“ der Zeitschrift nannte und ihn dabei
in eine Reihe stellte mit vielen Persönlichkeiten des Musiklebens, deren Namen auch heute noch oft unvergessen sind. Das Verfahren, einen „Unwürdigen“ zu präsentieren
und zu protegieren, fiele andernfalls vor allem auf Scherchen selbst zurück, als habe er nicht beurteilen können, wem seine Fürsprache zugute kam.
[4] Artikel Windisch, Fritz in: Hugo Riemanns Musik-Lexikon, 10. Auflage
von 1922 (wie Fußnote [2]).
[5] Der Satz « Fermentation, c’est la vie sans l’air » (Gärung ist Leben ohne Luft) wird
auf Louis Pasteur (1822–1895) zurückgeführt, doch wird die Gärung ohne Sauerstoff heute nur als ein Teilgebiet der Fermentation betrachtet.
[6] Von dem Biochemiker Hugo Haehn stammt der Beitrag Zum 60. Geburtstag von
Prof. Dr. Fritz Windisch, in: Brauwelt, Jg. 95 (1955), Nr. 101 vom 20. Dezember 1955, S. 1693, ferner Biochemie der Gärungen (Lexikon) von Hugo Haehn (1952) und Bruno Drews, Haehn, Hugo, in: Neue Deutsche Biographie, Bd. 7 (1966), Seite 431 f., Online-Ausgabe.
[7] Zu den Informationen aus der Todesanzeige weiter unten. – Der „Vaterländische
Verdienstorden“ war eine 1954 gestiftete Auszeichnung in der damaligen Deutschen Demokratischen Republik, die in „Bronze“, „Silber“ und „Gold“ sowie in Form einer
„Ehrenspange zu Gold“ verliehen wurde. Vgl. den Wikipedia-Artikel http://de.
wikipedia.org/ wiki/Vaterländischer_Verdienstorden.
[8] Vgl. das Porträt von Peter Lietz: Wilhelm Windisch – ein Leben für die
Brauwissenschaft [zum 150. Geburtstag von Wilhelm Windisch am 6. Dezember], S. 3–7, mit dokumentarischen Fotos, in: Jahrbuch 2010 der „Gesellschaft für
Geschichte des Brauwesens e.V.“ (GGB) www.ggb-berlin.de; ISSN 1860-8922; vgl. auf der Webseite Periodika Bücher den Link ganz unten links: Jahrbücher, dann Liste der noch lieferbaren Jahrbücher: hier Jahrbuch 2010 mit Inhaltsangabe; erster
Beitrag der Ausgabe. Der Aufsatz, dessen Manuskript mir sein Verfasser freundlicherweise zur Verfügung stellte, ist mit 7 Abbildungen, darunter einem Foto von
Wilhelm Windisch versehen. Man erhält hier einen so guten wie schnellen Überblick über Leben und Schaffen von Wilhelm Windisch, zumal vielfach aus seinen Schriften
wie auch Briefen zitiert wird. Sein Sohn Fritz Windisch wird zweimal erwähnt (Ms-S. 18 und in Anmerkung [35] auf Ms.-S. 21). – Von Dr. Peter Lietz erschien ferner: Wilhelm Windisch zum Gedenken, in: Brauerei Forum. Fachzeitschrift der VLB
Berlin; Oktober-Printausgabe 9, Berlin 2010; vgl. http://www.vlb-berlin.org/brauerei-forum. Vgl. auch die folgende Fußnote [9].
Zu einem Chemiker „Wilhelm Windisch“ weist der Kalliope-Katalog der Staatsbibliothek in Berlin unter http://kalliope.staatsbibliothek-berlin.de/ drei Briefe nach, die aus den Jahren 1891 oder 1894 (der Online-Katalog nennt beide Jahre) und
1913 stammen. Der erste, in Leipzig verfasste, ist an die „J.-G.-Cotta'sche Buchhandlung“ in Stuttgart, die beiden anderen sind an den Komponisten Engelbert Humperdinck (1854 bis 1921) gerichtet. – Konnte ich bisher den früheren in Marbach deponierten Brief nicht einsehen, so wurden mir die beiden im September 1913
verfassten Briefe von der Handschriftenabteilung der Universitätsbibliothek Frankfurt am Main Johann Christian Senckenberg Anfang Juni 2012 in Form von pdf-Dateien
zugänglich gemacht; Signatur: Nachlass Engelbert Humperdinck AIb Nr. 5664 und 5665. (Besonders möchte ich mich bei Frau Brigitte Klein für ihre Unterstützung bedanken.)
Diese zwei Briefe an Humperdinck schrieb Wilhelm Windisch, als sein ältester
Sohn Hans (Johannes) das Pankower Realgymnasium ohne Abitur verlassen wollte, um Musik zu studieren. Gleichwohl muss er, den Worten seines Vaters zufolge,
ein exzellenter Schüler gewesen sein. Dem vorzeitigen Verlassen der Schule widersprach sein Vater aber, und er versuchte, den persönlichen Einfluss Engelbert
Humperdincks geltend zu machen. Dies lag umso näher, als Hans Windisch selbst den Wunsch geäußert hatte, dass Humperdinck, den er schon lange aus seinen Werken
kannte und verehrte, in dieser Frage zu Rate zu ziehen sei. So schrieb Wilhelm Windisch einen ersten Brief, in dem er die Problematik ausführlich schilderte. Ein
Antwortschreiben Humperdincks erfolgte offenbar umgehend, wie der zweite Brief von Wilhelm Windisch erkennen lässt; doch war Humperdincks Antwort nicht Teil des
Bestands der Handschriftenabteilung der Frankfurter Universitätsbibliothek und ließ sich auch sonst nicht auffinden. Seine Antwort müsste aber zwischen dem 24. und 30.
September 1913 verfasst sein, denn diese Daten tragen die beiden Briefe Wilhelm Windischs. In seinem zweiten Brief kündigte Windisch den Besuch seines Sohnes Hans
für den Tag darauf an (für Mittwoch-Nachmittag, den 1. Oktober 1913), doch ob dieser Besuch wirklich stattfand, geht aus den Quellen nicht hervor. Humperdinck lebte
etwa von 1900 bis 1920 in Berlin (Nikolassee, Dreilindenstraße 3) und war unter anderem Leiter einer Meisterklasse für Komposition an der Preußischen Akademie der
Künste. Es dürfte ihm daher nicht allzu schwer gewesen sein, den erwünschten Besuch einzurichten (vgl. Berliner Adreßbuch 1913, Teil I, S. 1464, Spalte [2]). Auf diesem
Hintergrund ist auch die Bitte Wilhelm Windischs verständlich, den sehr kurzfristig anberaumten Besuchstermin telefonisch eventuell noch abzusagen.
Fritz Fridolin Windisch wird in diesen Briefen nur insofern erwähnt, „als er [Hans
Windisch] mit seinem jüngeren Bruder Ostern übers Jahr das Abiturienten-Examen machen“ würde (Brief vom 24.9.1913, S. [1]). Zu Hans Windisch vgl. Windisch- Sartowsky, Hans (Komponist) sowie Anm. [81].
In dem von Fritz Windisch 1934 geführten Prozess wurde die Schulzeit der beiden
Brüder brieflich nochmals erwähnt, und zwar von Dr. F. Walt(h)er, einem der einstigen Lehrer an dem Pankower Realgymnasium. So schrieb Walt(h)er, soweit er sich noch an die Vorfälle „nach etwa 23 Jahren erinnern“ konnte, am 7. Februar 1934 aus Saalberg an den „Rechtsanwalt“ [Dr. Waldemar Adler?], der ihn offenbar befragt hatte „[Fritz Fridolin] W[indisch] war ein sehr fähiger Schüler, im Unterricht, namentlich in Geschichte, interessiert u[nd] aufmerksam, im Wesen sehr zurückhaltend und ruhig;
es ist mir keinerlei Vorkommnis im Gedächtnis, bei dem er mir gegenüber sehr hervorgetreten wäre, besonders nicht unliebsam, im Gegensatz zu seinem Bruder Hans,
den ich länger unterrichtet habe und dessen Klassenlehrer ich auch eine Zeitlang war.“ Auf S. 2 in der Abschrift seines Briefes, die ich aus dem Fritz-Windisch-Nachlass
(FWN) erhielt, fährt er fort: „Nach dem Kriege [Erster Weltkrieg] habe ich von beiden Brüdern W[indisch] hier und da gehört und auch einmal an der Anschlagsäule etwas
von der Vorführung eigener Kompositionen gesehen: vermutlich war Fritz W[indisch] der Vorführende. Dagewesen im Konzert bin ich nicht, könnte auch niemand namhaft
machen, der genaueres wüsste.“ Dieses Antwortschreiben steht möglicherweise in Verbindung mit einem anderen Brief, den Artur Klinghammer am 6. Oktober 1933 an
den Lehrer „Professor Walther“ in „Oberschreiberhau (Niederschreiberhau?)“ gerichtet hatte. (Der 2-seitige Brief wurde mir ebenfalls aus dem FWN als Abschrift zugänglich
gemacht.) Ob die Briefe, die nur einige Monate auseinander liegen, zusammengehören, kann erst weitere Forschung zeigen. Klinghammers Tätigkeit wird mehrfach im dritten
Teil dieses Aufsatzes genannt, vgl. hier.
In der Voruntersuchung zu demselben Gerichtsverfahren kamen die Brüder Windisch
erstmals in einem Brief des Rechtsanwalts Dr. Wolfgang Zarnack zur Sprache, und zwar in einem Brief vom 15. Juni 1933, der an Dr. R. Koch am „Institut für
Gärungsgewerbe“ gerichtet war (FWN). Hier heißt es auf S. [1] unter den Nrn. 5, 6 und 7, dass Koch „im Laufe eines Gesprächs“ sinngemäß folgende Beschuldigungen
gegen Dr. Fritz Windisch erhoben habe: 5.) Herr Prof. [Wilhelm] Windisch habe sich „öffentlich in der Vorlesung über seine beiden Söhne beklagt“, 6.) dass „Herr Dr.
[Fritz] Windisch in kommunistischen Blättern Artikel veröffentlicht habe“ und 7.) „[d]er Bruder Herrn Dr. [Fritz] Windischs [also Hans Windisch] habe in kommunistischen
Blättern die musikalische Kritik ausgeübt.“ (Diese Behauptungen konnte ich nur teilweise bestätigen, doch wurden mir keine Kritiken von Hans Windisch in
kommunistischen Blättern bekannt, und ebenso weiß ich nichts von einer Äußerung in einer Vorlesung.)
[9] J[ohann] C[hristian] Poggendorff, Biographisch-literarisches Handwörterbuch der exakten Naturwissenschaften, hg. von der Sächsischen Akademie der
Wissenschaften zu Leipzig, Redaktion: Prof. Dr. Rudolph Zaunock und Prof. Dr. Hans Salié, Bd. VIIa, Teil 4 (S–Z) II, Berichtsjahre 1932–1953, Berlin: Akademie-Verlag,
1962, Seite 1019–1021 der Artikel Windisch, Friedrich mit Verzeichnis naturwissenschaftlicher Publikationen. In diesem Artikel sind auch die Lebensdaten
Fritz Windischs angegeben, und ungeachtet der Angabe der Berichtszeit finden sich in dem Lexikon die Veröffentlichungen Windischs bis 1960. Im selben Nachschlagewerk
folgt unmittelbar (auf S. 1021) ein Artikel über den Vater, den Gärungschemiker Wilhelm Windisch (geb. am 8. Dezember 1860 in Schmitten im Taunus, etwa 36 km
nordwestlich von Frankfurt am Main; gest. am 26. September 1944 in Berlin); die Informationen dieses Artikels, so wird mitgeteilt, gehen auf seinen Sohn Friedrich
Windisch zurück. Freundlicher Hinweis von Michaela Knör, Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei in Berlin (VLB) e.V., Bibliothekarin der Lorberg-Bibliothek/Lorberg
Library. Da Windisch hier an dem Vorgänger-Institut gearbeitet hatte, fragte ich nach Einzelheiten an. Dabei war zu erfahren, dass die Personalakte Windischs nicht mehr
vorhanden sei und vermutlich bei einem Bombenschaden im Zweiten Weltkrieg vernichtet wurde (Auskünfte ebenfalls von Michaela Knör – siehe oben – im Dezember 2010).
Von Wilhelm Windisch erschienen unter anderem die Bücher Das chemische Laboratorium des Brauers (5. Aufl., Berlin: Paul Parey, 1902; 6. Aufl. ebd., 1907)
oder die Übersetzung aus dem Englischen des Buchs von Joseph Reynolds Green Die Enzyme (Berlin: Paul Parey, 1901). 1925 wurde die 2. Auflage des von Max Delbrück begründeten Illustrierten Brauerei-Lexikons unter der Mitwirkung von Wilhelm
Windisch veröffentlicht (hg. von Max Delbrück und Friedrich Hayduck, Berlin: Parey, 1925), 2 Bde. – Für den 8. Dezember 1860 verzeichnet die Webseite der Berlin Chronik (http://www.luise-berlin.de/kalender/tag/dez08.htm): „Wilhelm Windisch wird
in Schmitten (Obertaunus) geboren. Seit 1885 war Windisch Mitarbeiter des Instituts für Gärungsgewerbe und Stärkefabrikation an der Landwirtschaftlichen Hochschule Berlin.“
[10] Vgl. Berliner Adreßbuch 1895, Teil I, S. 1507, Sp. [3] den Eintrag „[Windisch]
J., Mälzer, SO [Berlin, Südost] Wienerstraße 21, IV. [Stockwerk]“; ferner im Berliner Adreßbuch 1896, Teil II, S. 1182, Sp. [1] der Eintrag „[Windisch] J., Brauer, SO
[Berlin, Südost] Wienerstraße 21, III. [Stockwerk]“. Man bedenke, dass Fritz Windisch ein eigenes „Institut für Brauerei und Mälzerei“ eröffnete; vgl. Fußnote [19]. –
Im Jg. 1897 des Berliner Adressbuchs (Teil I, S. 1426, Sp. [1]) steht statt dem Beruf bei „Windisch J.“ die Angabe „Invalide“ (Wohnort in Berlin-Schöneberg, Colonnenstr.
40 II), und ich vermag nicht zu sagen, ob hier dieselbe Person wie der Mälzer und Brauer gemeint ist.
[11] Das Foto, auf das mich Michaela Knör in Zusammenhang mit dem folgenden
Aufsatz dankenswerterweise hinwies (vgl. Fußnote [9]), begleitete auf S. 372 den Beitrag von Dr. Willy Nordheim: Prof. Dr. habil. Friedrich Windisch – 65 Jahre,
in: Brauwissenschaft (heute hier), 13. Jg., Nr. 12, Nürnberg: Fachverlag Hans Carl,
1960, S. 372–379. – Das Foto wurde von der noch vorhandenen originalen Vorlage im November 2010 neu eingescannt, und die Eingabe ins Internet erfolgt mit
freundlicher Genehmigung des Fachverlags Hans Carl GmbH in Nürnberg. Frau Dr. Lydia Winkelmann, der Chef-Redakteurin für alle auf die Brauerei bezogenen
Zeitschriften des Verlags, ist vielmals zu danken für ihre Bemühungen im Oktober/November 2010.
[12] Seit dem 10. September 1936 war, laut dem Berliner Straßenlexikon
(© 2009–2010 Luisenstädtischer Bildungsverein), die Lindenstraße in Grabbeallee umbenannt; die Hausnummern änderte man später, so dass aus der ursprünglichen „Lindenstraße 35b“ im Jahre 1937 übergangsweise die „Grabbeallee 35b“ und dann im Berliner Adreßbuch 1938 erstmals die „Grabbeallee 48“ wurde. Heute gehört
Niederschönhausen zu Pankow in Berlin.
[13] Zu Müllers Deutschem Musiker-Lexikon vgl. Fußnote [2], zu Wilhelm Windisch
Fußnote [8] und den zweiten Absatz von Fußnote [9].
[14] Das vorausgehende Blatt 115 ist das Begleitschreiben der Dissertation des cand.
phil. Fritz Windisch vom 11. November 1925, das an den Dekan der Philosophischen Fakultät Berlin gerichtet ist. Windisch erwähnte hier zugleich den Titel seiner
Dissertation sowie die beigefügten „Personalpapiere“. Hierbei sprach er die Bitte aus, im Rahmen seines Doktorexamens im Hauptfach Chemie und den Nebenfächern
Botanik, Geologie und Philosophie geprüft zu werden. Blatt 142 (Phil. Fak. 651) enthält den in der Dissertation abgedruckten Lebenslauf von Windisch, der oberhalb
seiner Danksagung an Carl Neuberg steht. Dieser gedruckte Lebenslauf, der – abgesehen von der Ausschreibung eines bis-Striches und der Aufhebung der
Namenssperrung – identisch ist mit dem masch. und handsignierten sechszeiligen Lebenslauf (Lebenslauf I, siehe oben), lautet: „Ich, Fritz Windisch, bin geboren am 20.
Dezember 1895 zu Niederschönhausen, erhielt das Maturitätsexamen 1916 am Real-Gymnasium zu Pankow, stand von 1914 bis 1918 im Marinedienst und studierte
danach Chemie, Physik, Physiko-Chemie, Botanik, Geologie, Philosophie in Berlin und Leipzig.“
Die gedruckte Fassung von Windischs Dissertation hat die folgende Titelseite
(dem Archiv der „Humboldt-Universität“ ist für eine Fotokopie des Dokuments zu danken): Über das Wesen der Essiggärung | und die chemischen Leistungen |
der Essigbakterien | Inaugural=Dissertation | zur | Erlangung der Doktorwürde | genehmigt von der | hohen philosophischen Fakultät der | Friedrich Wilhelm=
Universität zu Berlin | von | Fritz Windisch | aus Niederschönhausen | Tag der Promotion 21. Dezember 1926 | Verlagsbuchhandlung Julius Springer in Berlin | 1926 (die hier erwähnte „Friedrich Wilhelm=Universität zu Berlin“ wurde 1949
in „Humboldt-Universität“ umbenannt).
[15] Alle drei Lebensläufe wurden mir neben anderen Dokumenten zu Windisch als
Fotokopie vom Archiv der „Humboldt-Universität“ Berlin im Oktober-November 2010 freundlicherweise zugänglich gemacht. (Kursives im Original gesperrt.)
[16] Eine weitere Bestätigung der Lebenszeit Friedrich Windischs (20.12.1895 bis
7.4.1961) konnte ich von der Friedhofsverwaltung in Berlin-Pankow erhalten, wo sich einst auf dem Friedhof Pankow III, Bürgerpark 24 (ehemals Bahnhofstraße) das Grab
Friedrich Windischs in Abteilung 1, Sonderstellen, Reihe 1 als Grab Nr. 8 befunden hatte. Die Grabstätte ist seit 1986 abgelaufen und nicht mehr vorhanden.
Nutzungsberechtigt war Marie Windisch, die Ehefrau von Friedrich Windisch, doch liegen keine weiteren Angaben über Hinterbliebene vor. (Freundliche briefliche
Auskünfte von Frau Stephan, Friedhofsverwaltung des Bezirksamtes „Pankow von Berlin“, Amt für Umwelt und Natur, von Berlin, am 16. November 2010).
Bestätigt wird das Geburtsjahr 1895 ferner durch die beiden Gratulations-Aufsätze zu Windischs 60. und 65. Geburtstag, die 1955 und 1960 in den Zeitschriften Brauwelt und Brauwissenschaft erschienen (vgl. Fußnote [6] und [22]). – Zurückführen lässt sich die (irrtümliche) Datierung „1897“ vermutlich auf Riemanns Musik-Lexikon von 1922 (vgl. Fußnote [2]).
Hinsichtlich der verschiedenen von Fritz Windisch gebrauchten Vornamen teilte mir Dr.
Christian Windisch mit: „Der Vollständigkeit halber möchte ich noch erwähnen, dass der amtliche Name meines Vaters Friedrich Karl Windisch lautet. Sein Rufname war
Fritz, daraus hat er den Künstlernamen Fritz Fridolin erfunden.“ (Briefliche Mitteilung am 12. Juni 2012.) Näheres zu den Vornamen hier.
[17] Vgl. Fußnote [12] zur Umbenennung von Name und Hausnummern der Lindenallee.
[18] Vgl. hierzu Hinderk Conrads und Brigitte Lohff, Carl Neuberg – Biochemie, Politik und Geschichte. Lebensweg und Werk eines fast verdrängten Forschers, Wiesbaden: Franz Steiner Verlag, 2006 (Reihe: Geschichte und Philosophie der
Medizin, Bd. 4); hier zu Fritz Windisch S. 27, 163, 164, 185, 195, 221. Archivalien zu Fritz Windisch aus den Jahren 1948–56 in Box 18 von Neubergs Nachlass (siehe hier unter Series I: Correspondences). – Carl Neuberg wurde auf Grund seiner jüdischen Abstammung 1936 zum Rücktritt gezwungen; er verließ Deutschland im Jahr darauf. –
Carl Neuberg und Fritz Windisch veröffentlichten 1925/26 gemeinsam mehrere Arbeiten über die Essiggärung; vgl. das Verzeichnis der Arbeiten und Veröffentlichungen von Friedrich Windisch (wie Fußnote [22]), S. 375 ff., Nr. 1–4. – Siehe auch: Carl Neuberg und Fritz Windisch (Berlin-Dahlem), Vom Wesen der
Essiggärung und von verwandten Erscheinungen, in: Die Naturwissenschaften. Wochenschrift für Fortschritte der reinen und der angewandten Naturwissenschaften, hg. von Arnold Berliner, 13. Jg., Heft 49/50: „Aus den
Forschungen und den Jahresberichten der Kaiser Wilhelm=Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften“, Berlin: Julius Springer, 4.12.1925, S. 993–996; Download hier.
[19] Im Berliner Adreßbuch 1936 ist in Teil I auf S. 2979 in Sp. [4] angegeben: „Fritz
[Windisch], Dr techn[isch-]wissenschaftl[iches] Instit[ut] N4 Invalidenstraße 102 T[elefon]“. Im selben Jahrgang des Adressbuchs befindet sich unter Invalidenstraße 102
der Eintrag: „Institut f[ür] Brauerei u[nd] Mälzerei T[elefon]“ (Teil IV, Seite 383, Sp. [1]); das Berliner Adreßbuch 1937 wiederholt die Angaben im Wesentlichen (Teil IV,
S. 384, Sp. [3]), und letztmalig erscheint das Institut Windischs im Berliner Adreßbuch 1938 (Teil IV, S. 396, Sp. [7]). – Die Invalidenstraße befindet sich in
Berlin nordöstlich des Tiergarten-Parks; Windischs Institut habe „gegenüber der Landwirtschaftlichen Fakultät der Humboldt Universität“ gelegen (Dr. Peter Lietz: vgl. Fußnote [8]). – Vgl. auf Webseite 3 den Abschnitt Die Institutsgründung.
[20] Zu Carl Neuberg vgl Fußnote [18].
[21] Vgl. weitere Einzelheiten in dem weiter unten zitierten Lebenslauf II (hier). Der § 6
des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7. April 1933 befindet auf S. 175 ff. des Reichsgesetzblattes, Teil I (Nr. 34, ausgegeben zu Berlin am 7. April 1933); § 6 auf S. 176. – In diesem Paragraphen des Gesetzes, der nur aus
sechs Textzeilen besteht, wird freilich nicht auf die Beschäftigung von Beamten eingegangen, die jüdischen Lehrkräften enger verbunden waren.
[22] Für die Recherche des zitierten Dokuments habe ich Auste Wolff, Berlin, Archiv
der „Humboldt-Universität“, vielmals zu danken; Dank gebührt auch Dagmar Seemel und Dr. Winfried Schultze, dem Leiter des Archivs, aus dem ich am 22. Oktober 2010
unter anderem eine Fotokopie dieses Lebenslaufes erhielt. – Ein zweiter, jedoch gedruckter Text, der in ausführlicher Form Fritz Windischs Lebensweg nachzeichnet,
seine Forschungen beschreibt und zugleich Windischs wissenschaftliche Schriften zusammenstellt, ist: Dr. Willy Nordheim, Prof. Dr. habil. Friedrich Windisch – 65 Jahre, in: Brauwissenschaft, 13. Jg., Nr. 12, Nürnberg 1960, S. 372–379 (mit
Porträtfoto von Windisch); auf S. 375–379 ist ein 186-teiliges chronologisches Verzeichnis der Arbeiten und Veröffentlichungen von Friedrich Windisch
(beginnend 1925) abgedruckt. Da der Verfasser dieser Geburtstagsadresse mit Windisch zusammenarbeitete, gehen viele Informationen wohl direkt auf Windisch zurück (vgl. auch im Haupttext hier). – Für die Recherche und Überlassung einer Datei
dieses Aufsatzes ist Michaela Knör von der Berliner Lorberg-Bibliothek (siehe Fußnote [9]) vielmals zu danken.
[23] Gerhard Krüger (1908–1994); vgl. den gleichnamigen Wikipedia-Artikel unter http://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Kr%C3%BCger_%28NS-Funktion%C3%A4r %29.
[24] Vgl. Christoph Jahr unter Mitarbeit von Rebecca Schaarschmidt (Hg.), Die Berliner Universität in der NS-Zeit, Bd. 1: Strukturen und Personen,
Wiesbaden: Franz Steiner Verlag, 2005, hier das Kapitel von Steffen Rückl unter Mitarbeit von Karl-Heinz Noack, Studentischer Alltag an der Berliner Universität 1933 bis 1945 (Seite 115–142), Zitat von S. 120 (das Buch ist in einer Online-Teilausgabe einsehbar). Dem Zitat sind im Original in den Fußnoten 18 und 19 die betreffenden Quellen aus dem „Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz“ sowie
des Universitätsarchivs der „Humboldt-Universität“ beigefügt. Der Vorwurf, Anhänger des Kommunismus zu sein, dürfte sich auf das literarische Werk Windischs gestützt
haben, das an späterer Stelle behandelt wird (vgl. Kapitel 5). Zum Begriff des „kurz darauf“ im letzten Satz vgl. Fußnote [28], zweiter Absatz.
[25] Vgl. die Quellenangabe in Fußnote [22].
[26] Erhard Landt (1900–1958); vgl. die Liste in http://www.synchron-publishers.com /texte/06-studien/0606lexikonliste.html#L bei Michael Grüttner, Biographisches
Lexikon zur nationalsozialistischen Wissenschaftspolitik (Reihe: Studien zur Wissenschafts- und Universitätsgeschichte; Bd. 6), Heidelberg: Synchron, 2004.
[27] Zu § 6 des Gesetzes vgl. Fußnote [21].
[28] Erneut ist hier zunächst ein von dem Bekannten abweichendes Geburtsjahr für Fritz Windisch eingetragen: „20.12.1898 in Berlin“. Die handschriftlichen Vermerke
lauten: Fachgebiet: Landwirtschaftswissenschaft, Amtsbezeichnung: Priv[at-] Dozent („Priv“ durchgestrichen); Personalakte: W 251 (Kursives im Original handschriftlich).
Eine zeitliche Differenzierung von Windischs Beurlaubung „mit sofortiger Wirkung“ und
seiner Entlassung wird in den Angaben bei St. Rückl und K.-H. Noack sichtbar (wie Fußnote [24]), denn in Fußnote 19 dieser Autoren sind zwei Ministerialerlasse mit
Datum vom 10.5.1933 sowie vom 1.6.1935 genannt. Da das zweite Datum auch auf der zitierten Karteikarte aus dem Bundesarchiv erscheint, hat sich die Entlassung
Windischs offenbar in zwei Schritten vollzogen, die zeitlich fast zwei Jahre auseinander lagen. Ob man bei dieser Zeitspanne noch von „kurz darauf“ sprechen kann, wie dies
die Autoren im Haupttext tun, sei dahingestellt. (Herrn Matthias Meissner, Bundesarchiv Berlin, ist für seine Recherchen und die Überlassung einer Fotokopie der genannten Karteikarte vielmals zu danken.)
[28a] Dieses Dokument erhielt ich als Fotokopie Anfang März 2012 aus dem Nachlass
von Fritz Windisch. – Zu Siegmund Peter Paul Kunisch (1900–1978), der die Verfügung abzeichnete, vgl. den gleichnamigen Artikel der Wikipedia hier.
[28b] Das Original des Furtwängler-Briefs befindet sich im FWN. Der Brief umfasst
nur 1 Seite, ist hier ungekürzt und hat im Briefkopf die vorgedruckte Adresse „BERLIN W 35 | GRAF-SPEE-STR. 9“. Das Datum sowie die Bemerkungen über
Fritz Windisch sind maschinenschriftlich, die Unterschrift ist handschriftlich. Weitere Informationen in den Wikipedia-Links über Wilhelm Furtwängler, Johannes R. Becher, den Kulturbund der DDR und über Johannes Stroux.
Dass die Zeitschrift Melos einen „linksradikalen Charakter“ hatte, ist mir zwar nicht
bewusst, kam aber dem Bild entgegen, das man sich im Nationalsozialismus machte, egal wie vielfältig und unterschiedlich die musikalischen Ansätze waren. Der Name
„Melos“ genügte, hiermit eine Bewegung für die Musik der Moderne abzutun, die von den Nationalsozialisten immer wieder als „Musikbolschewismus“, „Verfall“,
„zersetzend“, „ungesund“ und anderen Vokabeln mehr diffamiert wurde. Man unterstellte einen jüdischen Einfluss, den es ohne Zweifel gab, den es jedoch zugunsten
reiner deutscher und gesunder Meister-Musik „auszumerzen“ galt. Aus der überwältigenden Vielzahl von Äußerungen, die in diese Richtung gingen, sei ein Aufsatz
von Karl Hasse (1883–1961), Komponist und von 1933 bis 1945 Direktor der Kölner Musikhochschule, zitiert, der Neue musiktheoretische Lehrbücher benannt ist (abgedruckt in: Zeitschrift für Musik. Monatsschrift für eine geistige Erneuerung
der deutschen Musik, hg. von Gustav Bosse, 103. Jg., 1. Halbjahr, Januar mit Juni 1936, Heft 1, Regensburg: Gustav Bosse, Januar 1936, S. 36–40, „Fortsetzung“). Hier
bezieht Hasse Ernst Peppings Buch Stilwende der Musik (Mainz: Schott, 1934) ein
und äußert sich über eine Besprechung in der (nationalsozialistischen) Zeitschrift Die Musikpflege kritisch (S. 37): „Also Adolf Hitlers Werk und das Werk etwa des
,Melos‘-Kreises sind hier ohne weiteres als parallel laufend, das Aufbauende und das Zersetzende als selben Sinnes erkannt.“ Ähnliches ist auf S. 39 zu lesen.
[28c] Der „Offene Brief“, den Windisch erwähnt, ist jener Brief, der am 16. Februar 1946 in der Berliner Zeitung unter dem Titel Berlin ruft Wilhelm Furtwängler
auf der Titelseite abgedruckt wurde. Die näheren Umstände dieses Briefes sind beschrieben in dem Kapitel Das Tauziehen um Furtwängler, in: Hans Borgelt, Das war der Frühling von Berlin. Eine Berlin-Chronik, 1. Auflage, München: Franz
Schneekluth Verlag, © 1980 (Vorwort auf S. 8: „Berlin, im Herbst 1980), 447 S., S. 201–(219). Der Haupttitel des Buchs scheint erst ab der 2. Aufl. (1983) um den
Zusatz „oder die goldenen Hungerjahre“ erweitert worden zu sein, da er sich in der konsultierten 1. Aufl. nur in dem hinteren Umschlagtext oder dem Fließtext, nicht aber
auf dem Titelblatt befindet. Borgelt war zunächst Alleinverfasser des Briefs an Furtwängler, doch wurde sein Text so stark von Rudolf Herrnstadt redigiert, dass von
seinen Formulierungen „kein einziger Satz übriggeblieben“ ist (S. 204). In Borgelts Buch ist neben Auszügen aus diesem Brief auch eine Auswahl aus der Liste der „[e]twa
zwei Dutzend Namen“ (darunter zu Anfang Johannes R. Becher und Prof. Dr. Stroux) zu finden, die den Brief unterschrieben hatten (S. 205). – Vgl. ferner Anne Hartmann
und Wolfram Eggeling Sowjetische Präsenz im kulturellen Leben der SBZ und frühen DDR 1945–1953, Berlin: Akademie Verlag, 1998, Reihe: Edition Bild und Wissenschaft, Bd. 7, S. 153, Online-Teilausgabe. Die Darstellung des Falles folgt hierbei (laut S. 153, Fußnote 49) dem zuvor genannten Buch von Borgelt. Siehe auch Ursula Heukenkamp (Hg.), Unterm Notdach. Nachkriegsliteratur in Berlin
1945–1949, Berlin: Erich Schmidt Verlag, 1996, S. 472, mittlere Spalte, Zeittafel, Online-Teilausgabe.
[28d] Furtwängler lebte damals mit seiner Familie in Wien, vgl. Hans Borgelts Buch
(wie die vorige Anmerkung) S. 204 oben oder auch S. 206, wo Furtwänglers aus Wien kommende briefliche Antwort vom 24. Februar 1946 zitiert wird.
[28e] Maschinenschriftliche Abschrift im FWN.
[28f] Briefkopf und Kontoangaben sind vorgedruckt; das Schreiben an Windisch
ist masch., seine Unterzeichnung handschriftlich ausgefertigt. Das ergänzte Komma ist durch einen Textverlust am rechten Briefrand bedingt (Original im FWN).
[29] Kursives im Original in normaler Schrift, jedoch deutlich größeren Typen. (Für die
Recherche und die Übersendung einer Datei im Oktober 2010 habe ich Gerhard Mesli, Berlin, Landesarchiv Berlin, vielmals zu danken.) Über die Grabstelle von Fritz Windisch siehe Fußnote [16].
[29a] Der Brief von Fritz Windisch, den mir sein Sohn Anfang April 2012
als Fotokopie zusammen mit einem eigenen Brief schickte, datiert vom 17. März 1961. Die Klinik in Hachen / Sundern arbeitet noch heute unter Evers Namen als
Fachkrankenhaus für Neurologie und kann auf ein über vierzigjähriges Bestehen zurückblicken (http://www. klinik-dr-evers.de/startseite.html).
[30] Undatierter Lebenslauf II im Archiv der „Humboldt-Universität“ Berlin (vgl. Fußnote [15]), Blatt I (handschriftlich oben rechts die Paginierung „17“); ebenso wird der Marinedienst erwähnt in dem kurzen Lebenslauf I (Dissertation); vgl. Fußnote [14]. Zum Begriff „dienstunbrauchbar“ vgl. Anm [33].
[31] Quästur ist die frühere Bezeichnung der Finanzbehörde einer Universität.
[32] Eintragungen unter „Wohnung“ auf Windischs Quästurkarteikarte (Signatur: UAL,
Quästurkartei; Universitätsarchiv Leipzig).
[33] Die allgemeine Regelung besagt in §. 15. (S. 49) des „Reichs-Militärgesetzes“
vom 2. Mai 1874 (Deutsches Reichs-Gesetzblatt, Nr. 15 von 1874, S. 45 ff.): „Militärpflichtige, welche wegen körperlicher oder geistiger Gebrechen dauernd
dienstunbrauchbar befunden werden, sind vom Militärdienst und von jeder weiteren Gestellung vor die Ersatzbehörden zu befreien.“
[34] Vgl. das in Fußnote [30] belegte Zitat.
[35] Vgl. den Artikel Kieler Matrosenaufstand in der Wikipedia.
[36] Arthur Hantzsch (1857–1935), Chemiker; an der Universität Leipzig von 1903 bis 1927; vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Arthur_Hantzsch.
[37] Schäfer; bislang ist unklar, wer hier gemeint ist.
[38] Siehe Fußnote [36]
[39] Wilhelm Friedrich Philipp Pfeffer (1845–1920), Botaniker; wurde 1887 an
die Universität Leipzig berufen. Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Pfeffer.
[40] Der Physiker Otto Heinrich Wiener (1862–1927) wurde 1899 an die Leipziger Universität berufen. Vgl. hier.
[41] Johannes Volkelt (1848–1930) lehrte von 1894 bis 1921 an der Leipziger Universität; vgl. hier und hier (neu in Vorbereitung). Ein download zahlreicher Schriften
ist hier zu finden.
[42] Max Brahn (1873–1944), Psychologe; arbeitete seit etwa 1911 an der Leipziger Universität; vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Max_Brahn.
[43] Eine Fotokopie aus dem nach Nummern geordneten Immatrikulations-Buch mit
Spaltenvordrucken und handschriftlichen Eintragungen (Bestand: 108. Rektorat) belegt in Spalte 2 die Immatrikulation. In dem gedruckten Studentenverzeichnis der
Universität, von dem ich die S. 365 in Fotokopie erhielt, ist Fritz-Fridolin Windisch unter der genannten Matrikelnummer ab Michaelis [29. September] 1918 erfasst.
[44] Kursives steht für Handschriftliches des Dokuments.
[45] Dokument des Archivs der „Humboldt-Universität“ zu Berlin, Bestand: Phil. Fak.
651; rechts oben die handschr. Blattzählung „119“. Vgl. über die „Kaiser Wilhelm Gesellschaft“, deren Grundlagenforschungen von der „Max-Planck-Gesellschaft“ nach
1945 übernommen wurden, den betreffenden Wikipedia-Artikel.
[46] Vgl. den bibliografischen Zitierlink für die Dissertation bzw. die Habilitation von
Windisch. – Die Angaben Letzterer konnten durch ein antiquarisches Exemplar vervollständigt werden, in dem es auf der Titelseite heißt: Die Bedeutung des
Sauerstoffs für die Hefe und ihre biochemischen Wirkungen. Als Habilitations- Schrift zur Erlangung der venia legendi dem Hohen Senat der Landwirtschaftlichen
Hochschule zu Berlin vorgelegt von Fritz Windisch. Druck von Gebr. Unger, Berlin SW 11, Bernburger Straße 30. Auch hier wurde die Datierung der Schrift mit 1932 angezeigt.
[47] Vgl. das durch Fußnote [19] belegte Zitat sowie das Unterkapitel Institutsgründungen in Kapitel 7.
[48] Vgl. den ersten Satz in dem von Fußnote [22] belegten Zitat des Lebenslaufs III
aus dem Jahre 1948.
[48a] Erst nach dem Zweiten Weltkrieg wurden in Briefen Windischs seine Mutter und
andere Familienangehörige genannt; vgl. das Zitat in Anm. [185a], letzter Absatz.
[49] Vgl. die bibliografische Zusammenstellung hier.
[50] Vgl. Fußnote [16].
[51] Briefliche und telefonische Mitteilungen von Dr. Peter Lietz im Januar 2011, der
Windisch in Vorlesungen gehört hatte und gelegentlich noch in Kontakt steht zu Windischs Assistenten Dr. Willy Nordheim. In Lietz’ Aufsatz (vgl. Fußnote [8]) über
Wilhelm Windisch befindet sich auch die Abbildung des Titelblatts des Alkoholischen Lieds (vgl. Fußnote [58]).
[52] Archiv der Berliner „Humboldt-Universität“, Einzelheiten über das Studium von
Hans Windisch in Fußnote [81].
[52a] Brief (Fax) von Dr. Christian Windisch, Berlin, an den Verfasser am 2. Februar 2012.
[53] Auf Seite 236 in der rechten Spalte; vollständige bibliografische Angaben in Fußnote [2], zweiter Absatz.
[53a] Vgl. Berliner Adreßbuch 1927, Teil I, S. 3784, Sp. [3].
[54] Siehe Müller, Deutsches Musiker-Lexikon, 1929 (wie Anm. [2]), Sp. 1579 f.;
in diesem Fall steht kein Sternchen unter dem Artikel, und so müsste man davon ausgehen, dass die lexikalischen Angaben von Hans Windisch-Sartowsky selbst stammen (vgl. Anm. [2], zweite Häfte des ersten Absatzes).
Da Schmachtenhagen heute zu Oranienburg gehört, fragte ich in dem dortigen
Stadtarchiv an. Ich musste aber erfahren, dass hier nichts über den Genannten bekannt sei und eine meldebehördliche Erfassung erst ab 1953 stattgefunden habe. Auch in den
Adressbüchern von Oranienburg und Umgebung (Schmachtenhagen), im Kreismuseum Oberhavel oder dem „Heimatverein Schmachtenhagen e.V.“ (vertreten durch Herrn
Kurt Müller) wie in den personenstandlichen Unterlagen des Standesamtes ließ sich Hans Windisch-Sartowsky nicht nachweisen. (Freundliche Auskünfte von Christian
Becker, Stadtarchiv Oranienburg im November 2010 bzw. Januar 2011, Telefon bzw. E-Mail.)
[55] Vgl. http://lccn.loc.gov/unk84092912 oder auch http://d-nb.info/gnd/127332677. Da in der Titelaufnahme durch die „Library of Congress“, zu welcher der erste Link
führt, Richard Keßler [Kessler] als Operetten-Librettist genannt wird, der unter anderem durch Werke von Eduard Künneke, Walter Bromme, Richard Fall und
Robert Winterberg bekannt wurde, bestand Sartowskys Aufgabe vermutlich in der Vertonung der Texte. Vgl. auch die niederländische Webseite zu „Als de mens“ [neue Suche: Titel und Autor] für Gesangstimme und Klavier aus dem Jahr 1936.
[56] Vollständige bibliografische Angaben in Fußnote [2].
[57] Zitiert in dem Aufsatz von Peter Lietz (wie Fußnote [8]), Ms-S. 2), der in
seiner Anm. [3] (Ms-S. 21) die folgende Festschrift als Quelle angibt: H[einrich] Schulze-Besse, Festschrift der Cimbria zur Feier des 40-jährigen Bestehens, Berlin 1928 (lag nicht vor).
[58] Vgl. P. Lietz (wie Fußnote [8]), Ms-S. 17.
[58a] Brief von Dr. Christian Windisch an den Verfasser, „Berlin, den 3.4.[20]12“.
Fortsetzung in Teil 2
Erste Eingabe ins Internet: Montag, 7. Februar 2011 (Teile I und II); Freitag, 29. Juni 2012 (Teil III)
Letzte Ãnderung: Sonntag, 22. Mai 2016
© 2011–2016 by Herbert Henck
|